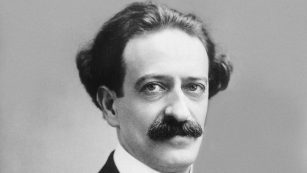Frau Siegert, warum klären Sie über den Holocaust ausgerechnet auf TikTok auf?
Eigentlich hat es als Experiment begonnen. Ich habe bei dem Thema eine Leerstelle gesehen, wollte die Sichtbarkeit verstärken und wusste, dass man über TikTok viele Menschen erreichen kann. Ich habe den Algorithmus als Chance genommen; er kuratiert das Thema; es findet quasi die Menschen.
Sie fordern: »Gedenken neu denken.« Was genau ist neu?
Das demokratische Element. Alle sollen die Möglichkeit haben, mitzumachen. Ich will Gedenken nicht outsourcen an die Nachfahren der Tätergeneration, sondern alle sollen die Familienbiografien und ihre Umgebung mit offenen Augen hinterfragen. Das muss nicht öffentlich passieren, oft ist das Private sogar wirkungsvoller. Hauptsache, die Erzählungen werden hinterfragt und hohle Phrasen wie »Nie wieder ist jetzt!« überwunden. Das leere Sprechen wird immer existieren, wenn es schwer ist, klare Worte zu finden. Aber man sollte sich die Macht der Sprache bewusst machen. Dies ist ein privater Prozess, man fühlt sich beim leeren Sprechen ertappt oder ertappt sich selbst. Es ist wichtig, dabei Unsicherheiten zuzulassen, sonst führt es zu Schweigen.
Wie kann man innerhalb von 90 Sekunden mehr als oberflächliches Wissen vermitteln?
Ich schneide keine breiten Themen an, sondern betrachte Kernaspekte. Kleine alltägliche Themen, die nicht viel Vorwissen erfordern. Dann betrachte ich deren Folgen und stelle die Themen in einen größeren Zusammenhang. Ich möchte Menschen aktivieren, zur eigenen Recherche bewegen. Es ist mir wichtig, Vertrauen aufzubauen. Dazu müssen meine Beiträge konsistent sein. Ich blende meine Quellen ein und stelle die Fragen in der Hook ohne »Von-oben«-Attitüde so, dass ich sie einlösen kann.
Sie kritisieren, dass Opfer teilweise voyeuristisch dargestellt werden. Wird dies durch TikTok verstärkt? Nimmt nicht die Brutalität im Netz, zumal infolge des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023, enorm zu?
Ich bin von meinem Archivmaterial abhängig, das oft aus nackten Leichen oder weinenden Interviewpartnern besteht. Ich muss es zeigen, um die Geschichten zu erzählen, will die Menschen aber nicht auf ihren Opferstatus reduzieren. Zumal diese Inszenierung der Täterblick ist. Der Naziblick. Damit will ich brechen, um zu zeigen, dass eine andere Sichtbarkeit möglich ist. Das Gleiche gilt für die Aufnahmen der Hamas, die Gewalt bewusst inszenieren. Einerseits ist es notwendig, sie zu zeigen, um die Realität abzubilden, doch will man nicht Teil der Propaganda werden und Täterideologien reproduzieren. Ich muss also jedes Bild sachlich und präzise einordnen. Und meine Quellen angeben, um das Vertrauen meiner User zu behalten.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch von negativen Kommentaren.
Es gab schon immer den Versuch, vom Holocaust abzulenken mit Verweis auf den Stalinismus oder die Alliierten oder Israel. Seit dem 7. Oktober 2023 passiert das beinahe täglich. Und der Hass gegen andere und gegen Jüdinnen und Juden hat enorm zugenommen. Wenn ein Video durch Weiterleitung die Bubble verlässt, wird es noch schlimmer. Da scheint der Hass so groß, dass die inhaltliche Gegenrede hoffnungslos ist.
Sie möchten sich nicht zum Nahost-Konflikt äußern. Doch gehört nicht zur »kollektiven Verantwortung«, die Existenz Israels als sicheres Refugium für Jüdinnen und Juden zu garantieren?
Meine Aufgabe ist es, die historische Einzigartigkeit des Holocaust aufzuzeigen. Ich sehe eine Gefahr darin, historisch falsche Parallelen zu ziehen. Es sollte nicht nur eine historische Verantwortung und Konsequenz aus dem Holocaust sein, gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels einzustehen, sondern eine moralische Verantwortung gegenüber den Lebenden.
Für ihren TikTok-Kanal @keine.erinnerungskultur wurde Susanne Siegert im September mit dem Margot-Friedländer-Preis und 2024 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. In ihrem Buch »Gedenken neu denken. Wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss« schildert sie die Erforschung ihres Heimatortes.
Mit der Autorin sprach Therese Klein.