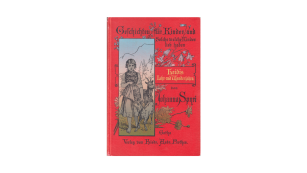Ein jedes Opfer des Coronavirus stellt für seine Mitmenschen eine Tragödie dar. Besonders tragisch jedoch erscheint es Außenstehenden, wenn es einen Menschen trifft, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, andere vor den Folgen des Virus zu bewahren, wie der jüdische Hausarzt Paul Alloun.
Er unterhielt 30 Jahre lang eine Praxis in La Courneuve im Norden von Paris, einer der am stärksten von Corona betroffenen Gemeinden Frankreichs – und gleichzeitig einer der ärmsten.
PATIENTEN Alloun selbst lebte im bürgerlichen Viertel von Saint Brice sous Forêt und, so sein Sohn Elie in der Tageszeitung »Le Quotidien«, hatte etliche Angebote, dort in einer Klinik zu arbeiten. Er wollte aber seine Patienten, die meist beengt in Sozialwohnungen leben, nicht allein lassen, schon gar nicht mit Corona. Schutzausrüstung stand in Frankreich selbst Ärzten erst spät zur Verfügung, zu spät für Paul Alloun. Er starb im Alter von 60 Jahren an Covid-19.
Das Virus, heißt es oft, schlage unerbittlich zu, und jeden könne es gleichermaßen treffen. Doch offenbarte schon eine erste Bilanz der Opferzahlen in Frankreich auffällig hohe Werte bei zwei Bevölkerungsgruppen – und der Tod des Arztes wirft ein Schlaglicht auf beide: Zum einen sind sozial benachteiligte Menschen stark betroffen, zum anderen beklagen die jüdischen Gemeinden überdurchschnittlich hohe Verluste.
Unter den mehr als 28.000 Menschen, die in Frankreich nachweislich an den Folgen einer Infektion starben, waren 1300 jüdisch. Das sind fünf Prozent aller Opfer – obwohl Juden kaum ein Prozent der französischen Bevölkerung ausmachen.
BEERDIGUNGSINSTITUTE Diese Zahl ermittelten israelische Journalisten aus den Angaben der jüdischen Beerdigungsinstitute.
Weil im laizistischen Frankreich offizielle Statistiken nach Religionszugehörigkeit der Opfer nicht veröffentlicht werden, schließen Beobachter nicht aus, dass die Zahl durchaus noch höher liegen könnte.
Fünf Prozent aller Covid-19-Opfer im Land sind jüdisch.
Eine erste Ursache wurde schnell ausgemacht: Nur wenige Tage, bevor Präsident Macron in seiner Fernsehansprache am 16. März dem Virus den »Krieg« erklärte, feierten die jüdischen Gemeinden noch unbeschwert Purim. Und da, wie Moche Taieb von der Synagoge des Pariser Vororts Neuilly berichtet, in der in Frankreich vorherrschenden sefardischen Kultur die körperliche Nähe eine große Rolle spielt, kam es zu »vielen Umarmungen, Küssen und Berührungen«.
Zudem sind Juden in medizinischen Berufen überproportional vertreten. Auch die Berufsgruppe der Metzger hat es besonders hart getroffen, was bereits zu einem Engpass bei koscherem Fleisch geführt hat. Und vor allem leben die größten jüdischen Gemeinden dort, wo sich auch die Corona-Hotspots befinden: im Großraum Paris und im Elsass.
RESILIENZ Entsprechend den staatlichen Vorgaben wurden die religiösen Stätten Mitte März geschlossen und die Gottesdienste, wie vielerorts weltweit, auf Online-Angebote umgestellt. Virtuelle Minjanim fanden sich über den Webkonferenzdienst Zoom zusammen.
Besonders schwer fiel der Verzicht auf die traditionellen Bestattungsriten wie die Totenwäsche, und dass Hinterbliebene das Kaddisch nur noch über WhatsApp lesen durften, brach manchem Beter fast das Herz.
Der bekannte französisch-jüdische Psychiater und Resilienzforscher Boris Cyrulnik sagte kürzlich in einem Radio-Interview mit dem Sender France Inter, er sehe vor allem bei sehr religiösen Menschen große seelische Verwerfungen voraus.
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN In gewisser Weise lässt sich das auch für die gesamte Gesellschaft und die Bewältigung der Corona-Krise sagen. So hat die Zunahme antisemitischer Verschwörungstheorien auch Frankreich erfasst. Die Mittelalterhistorikerin Claire Soussen legte kürzlich im jüdischen Onlinedienst »akadem« am Beispiel der Schwarzen Pest im 14. Jahrhundert dar, dass in Krisenzeiten Tendenzen, die ohnehin schon lange schwelen, im Krisenfall offen zutage treten.
»Synagogen dürfen keine Corona-Cluster werden«, warnt Oberrabbiner Haïm Korsia.
Die Beobachtungsstelle der jüdischen Dachorganisation CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) hatte mit einem KI-Algorithmus für 2019 mehr als 50.000 antisemitische Inhalte in sozialen Netzwerken ausfindig gemacht. Doch mit Corona, betont Marc Knobel, Studiendirektor des CRIF, erweitere sich der Kreis der Angegriffenen: Nicht nur antisemitische, rassistische und homophobe Äußerungen haben Konjunktur, die Angriffe zielten nun auch auf Asiaten, weil sie das Virus angeblich eingeschleppt hätten.
Das französische Parlament hat am 13. Mai ein auch vom CRIF lange gefordertes Gesetz zur Eindämmung von Hassposts beschlossen, das sich an das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz anlehnt. Doch der Grat, den man damit in einem Rechtsstaat beschreitet, ist schmal. So meldeten Anwaltsverbände und die EU-Kommission starke Bedenken an, die die Regierung in Paris jedoch abwehrt.
Das Ringen gegen den Hass wird Frankreich über die Corona-Krise hinaus beschäftigen, auch wenn die Beschränkungen nun allmählich aufgehoben werden.
SCHAWUOT Der Conseil d’État, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht und weisungsbefugter Rechtsberater der Regierung, ordnete am 18. Mai an, die Verbote für Gottesdienste innerhalb von acht Tagen aufzuheben. Und so kann seit Anfang der Woche in Frankreichs Synagogen, Kirchen und Moscheen wieder gebetet werden.
Schawuot wird also nicht mehr nur virtuell stattfinden. Frankreichs Oberrabbiner Haïm Korsia freut sich – doch er mahnt zur Vorsicht: Es gelte, Abstandsregeln einzuhalten und nur jeden dritten Platz zu besetzen. »Denn Orte des Gottesdienstes dürfen keine Corona-Cluster werden«, so Korsia, »vor allem nicht die Synagogen.