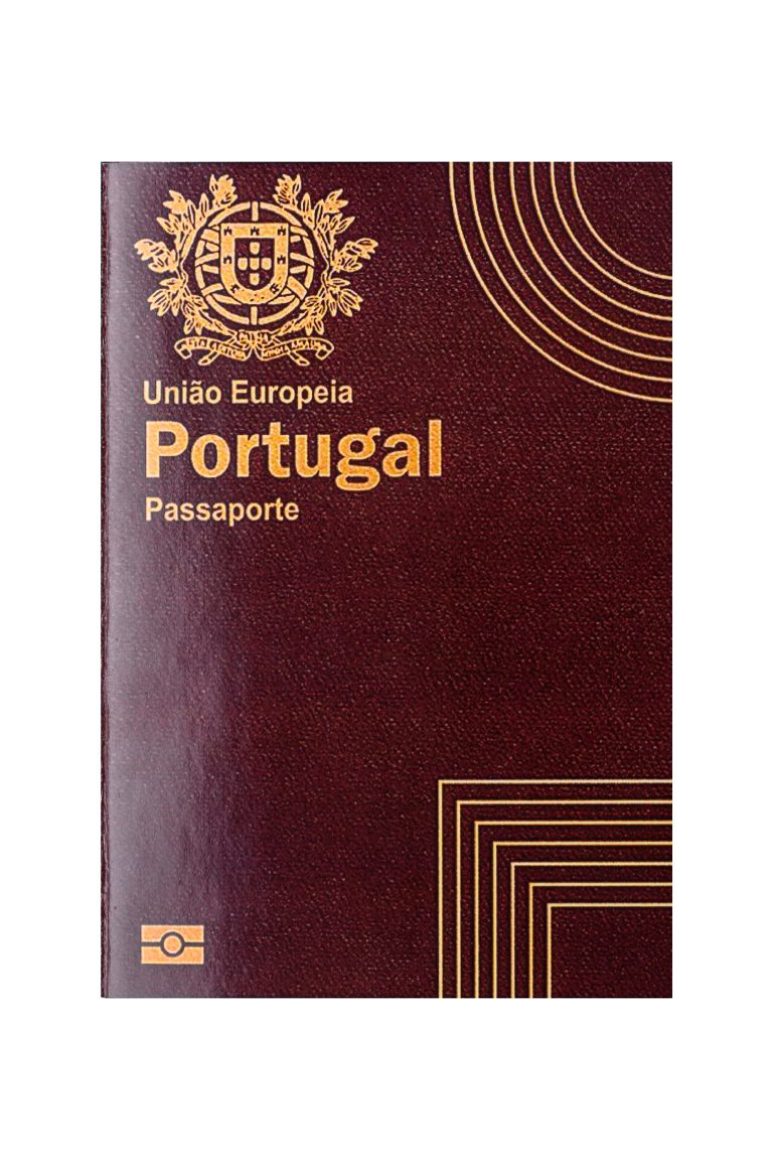Vor zehn Jahren machten Spanien und Portugal den Nachfahren von Juden, die vor einem halben Jahrtausend unter dem Alhambra-Edikt der katholischen Herrscher Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragón von der Iberischen Halbinsel vertrieben worden waren, ein Angebot. Sie sollten als Wiedergutmachung für das Unrecht, das ihre Familien erlitten hatten – Konversion oder Tod und die Verfolgung durch die berüchtigte Inquisition –, in den Genuss von portugiesischen oder spanischen Pässen gelangen.
Doch nun hat die konservative Lissaboner Minderheitsregierung von Ministerpräsident Luís Montenegro entschieden, dieses Privileg abzuschaffen. Sehr zum Leidwesen vieler Sefarden, die jetzt keine Möglichkeit mehr haben, auf vereinfachte Weise in das Land ihrer Väter zurückzukehren beziehungsweise an einen europäischen Pass zu kommen.
Für manche wurden Spanien und Portugal zum Fluchtpunkt und sicheren Hafen.
Hintergrund der Kehrtwende ist eine Neuausrichtung der portugiesischen Migrationspolitik. Montenegro, der bislang einen ausgesprochen liberalen Kurs in Sachen Einwanderung verfolgt hatte, beschloss mit Unterstützung von drei rechtsgerichteten Parteien ein Paket von gesetzlichen Maßnahmen, das zu den restriktivsten in ganz Europa zählt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sonderregelung für ein Rückkehrrecht sefardischer Juden gänzlich gestrichen.
Als Begründung wurde angeführt, dass es zu Unregelmäßigkeiten und Missbrauch gekommen sei. Eine juristische Aufarbeitung sei angestoßen worden. Ganz offensichtlich zielen diese Anschuldigungen auf einen bestimmten Personenkreis, nämlich auf russische Oligarchen mit jüdischen Wurzeln, wie etwa den milliardenschweren Unternehmer Roman Abramowich. Auch der hatte sich um die portugiesische Staatsbürgerschaft beworben und sie erhalten. Die russische und israelische besitzt er bereits.
Portugal ermöglichte die Einbürgerung für die Nachfahren vertriebener Sefarden länger als sein Nachbar Spanien. Dort war die Frist bereits im September 2019 abgelaufen, in der man einen entsprechenden Antrag stellen konnte. Sie wurde schließlich um ein Jahr verlängert, und dann um ein weiteres wegen der Corona-Pandemie.
Die Bedingungen für einen Antrag glichen sich in beiden Ländern weitgehend: Bewerber mussten nachweisen, dass sie Mitglied einer sefardischen Gemeinde sind. Sprachkenntnisse halfen, Portugiesisch oder besser noch Ladino, das mittelalterliche jüdisch-spanische Idiom. Sie mussten Familiennamen vorweisen, die sich auf von Spanien und Portugal ausgegebenen Listen wiederfanden, und dazu Stammbäume liefern, deren Einträge bestenfalls durch Geburts- oder Heiratsurkunden belegt wurden.
Auch ein polizeiliches Führungszeugnis wurde gefordert. Und das alles in kastilischer Sprache. Die Bearbeitung der Anträge dauerte mitunter Jahre. Vor allem, wenn man es selbst machte, anstatt sich einen Anwalt zu nehmen.
72.000 Pässe
Innerhalb von sechs Jahren gingen in Spanien fast 154.000 Anträge ein, gerechnet hatte man mit etwa 90.000, so offizielle Stellen. Die meisten Bewerbungen kamen hierbei aus Lateinamerika, vor allem aus Ländern wie Mexiko, Venezuela und Kolumbien. Rund 72.000 Pässe wurden seitdem ausgestellt.
Die Gründe, die Juden dazu veranlassten, einen spanischen oder portugiesischen Pass zu beantragen, sind vielfältig. In Venezuela hatte die Regierungszeit von Präsident Hugo Chavez (1999–2013) immer wieder blanken Antisemitismus zutage gefördert. Chavez selbst beschimpfte beispielsweise seinen innenpolitischen Gegner Henrique Capriles Radonski, dessen jüdische Vorfahren aus Polen kamen, in aller Öffentlichkeit vulgär wie wortreich als »Schwein«. Als Marranen, also Schweine, wurden im späten Mittelalter auch die auf der Iberischen Halbinsel zwangsgetauften Juden beschimpft.
Spätestens als im Jahr 2009 in Caracas die Synagoge Tiferet Israel überfallen und verwüstet wurde, entschlossen sich viele Gemeindemitglieder, Venezuela zu verlassen. Spanien und Portugal wurden zu Fluchtpunkten und sicheren Häfen, was nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Auch ökonomische Gründe spielten für viele eine Rolle. Vor allem Argentinier kämpfen nach wie vor ums wirtschaftliche Überleben. Das Land, das einst zu den wohlhabendsten in ganz Südamerika zählte, wurde durch Misswirtschaft und Korruption nahezu zerstört. Kein Wunder also, dass sich jüdische Bürger nach einer neuen Heimstatt umsahen. Auch wenn es sich mittlerweile etwas erholt hat und der derzeit amtierende Präsident Javier Milei, ein Katholik, als enger Freund Israels gilt.
Aber auch eine tief empfundene Nostalgie verbindet viele Sefarden mit Portugal und Spanien. Es gibt sogar Familien, in denen Schlüssel von Häusern, die sie einst auf der Iberischen Halbinsel besessen haben, von Generation zu Generation weitergegeben werden. So hat sich Sefarad, wie das Gebiet auf Hebräisch heißt, ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
Aufzeichnungen wiesen nach Portugal
Jonah Salita, ein 28-jähriger Fotograf und Kreativ-Berater aus den USA, hatte sich rechtzeitig auf die Spuren seiner Vorfahren begeben. Allerdings mit unerwartetem Ergebnis. Er war als aschkenasischer Jude aufgewachsen mit dem Glauben, dass seine Familie ursprünglich aus Russland stamme. Doch ein Bauchgefühl und Jahre der Nachforschungen führten ihn schließlich nach Portugal.
»Ich fand Aufzeichnungen, die nach Porto im Norden des Landes wiesen. Ich fuhr schließlich dorthin, lernte die Sprache und stellte bald auch den Antrag.« Das Zusammenstellen der nötigen Papiere sei anstrengend und kostenintensiv gewesen, berichtet er. Schließlich habe er den Pass aber nach nur sechs Monaten bekommen. »Als man ihn mir in die Hand drückte, war das einer der größten Momente meines Lebens.« Dabei hätte er ahnen können, dass seine Familie sefardische Wurzeln hat, sagt er und lacht: »Meine Familie isst schon immer Reis zu Pessach.«
Mit ernster Stimme fügt er hinzu: »Jetzt habe ich meine Identität gewissermaßen zurückgewonnen und kann verstehen, wer ich bin, wo ich hingehöre.« Und so zog er schließlich sogar für zwei Jahre in die portugiesische Hauptstadt.
Von 250.000 Anträgen auf Einbürgerung wurden in Portugal 23.000 genehmigt.
Rund 250.000 Anträge auf Einbürgerung sind seit 2015 bei den zuständigen portugiesischen Stellen eingegangen, heißt es. 76.000 davon wurden zur Prüfung akzeptiert. 23.000 wurden bisher genehmigt, so die für das Verfahren zuständige portugiesische Sonderkommission.
Noch seien nicht alle geprüft worden, aber das neue Gesetz lasse auch keine weitere Bearbeitung zu. Allerdings hat Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa es noch nicht unterschrieben, und daher ist es noch nicht in Kraft getreten. Vielleicht kann er das Parlament davon überzeugen, sich das Ganze noch einmal zu überlegen – und dann anders zu entscheiden.