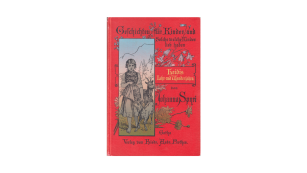»Ich gehe immer in Richtung Leben, nicht in Richtung Tod«, sagte Sara Rus bei einem Interview. Da war sie 89 Jahre alt. Und tatsächlich: Sara sprühte vor Leben und Energie, erzählte froh von ihren Urenkeln und ihrer Tanzgruppe. Einen Tag vor ihrem 97. Geburtstag ist sie nun in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben.
Dorthin war Sara Rus ausgewandert, nachdem sie das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hatte. Im KZ Mauthausen wurde sie als 18-Jährige von den US-Amerikanern befreit, da wog sie nur noch 30 Kilo. Ihre Mutter überlebte den NS-Terror ebenfalls, ihr Vater wurde in Auschwitz ermordet.
Sara Rus wurde 1927 als Scheijne Miriam Laskier in Lodz geboren. Im Ghetto der polnischen Stadt lernte sie ihren späteren Mann Benno kennen. In Argentinien wurde er zu Bernardo, gemeinsam bauten sie sich ein neues Leben auf und bekamen ihre Kinder Daniel und Natalia.
In dieser neuen Heimat erlebte Sara Rus später die zweite große Tragödie ihres Lebens: In den 70er-Jahren wurde ihr Sohn Daniel, ein 27-jähriger Atomphysiker, in Buenos Aires von Militärs verschleppt. Er ist einer der Tausenden von »desaparecidos«, Verschwundenen, der argentinischen Diktatur. Sara wurde zu einer der mutigen »Mütter der Plaza de Mayo«, forderte mit einem weißen Kopftuch Aufklärung über Daniels Schicksal – vergeblich. Lange weigerte sie sich, zu akzeptieren, dass ihr Sohn ermordet worden war.
Niemand hat ihr je seine sterblichen Überreste übergeben, sie und Bernardo hatten Daniel nicht begraben können. Nach Jahrzehnten der Suche schließlich bat Sara einen Rabbiner, für Daniel das Kaddisch zu sprechen. Viele Jahre lang ging sie in Schulklassen, um davon zu erzählen, wie sie zwei Schreckensregime, zwei Tragödien überlebt hatte. »Ich höre nicht auf, zu reden und zu kämpfen«, sagte sie. Ihre starke Stimme wird fehlen.