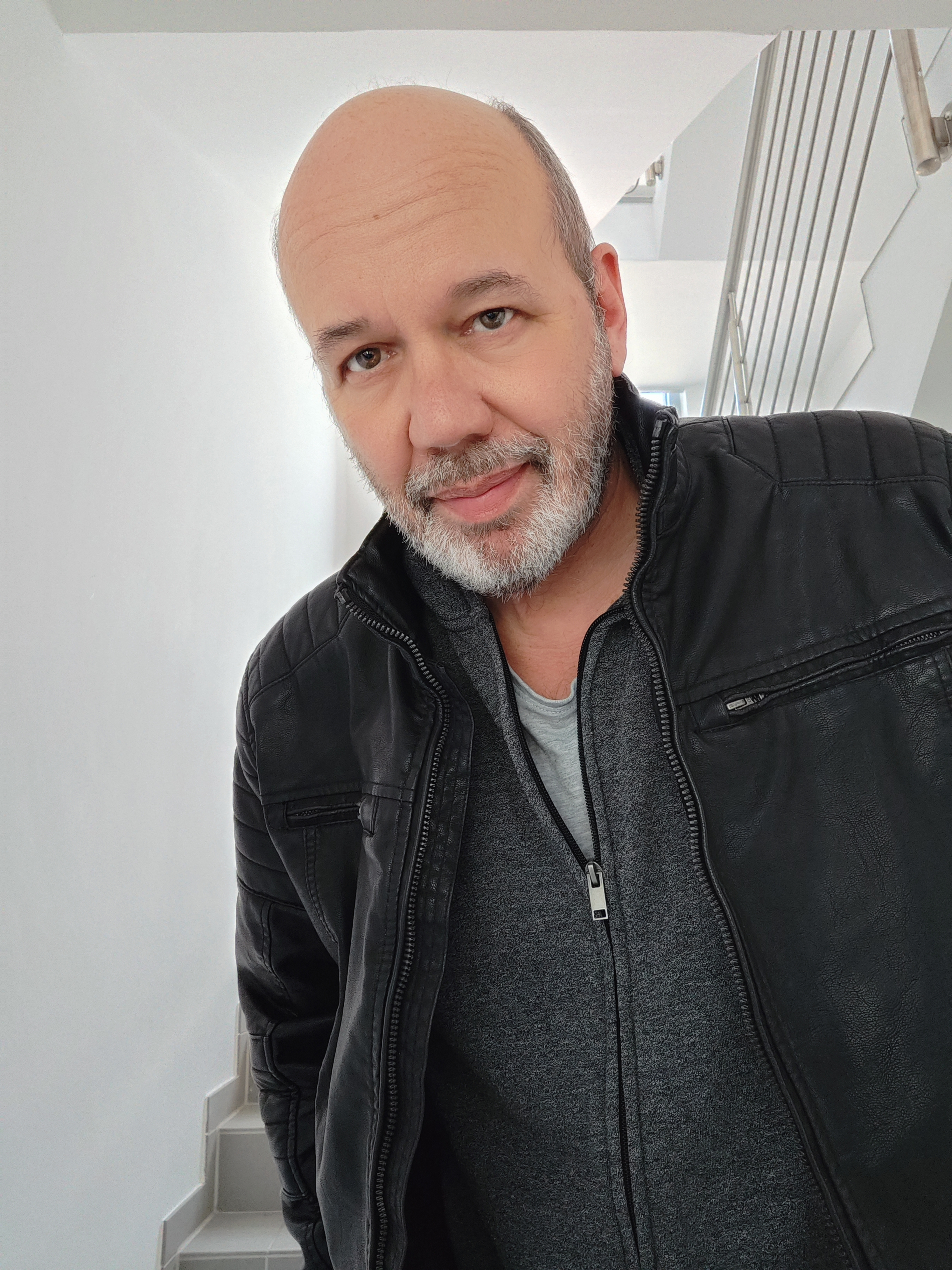Es war eine doppelte Ehrung für zwei ganz besondere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Niedersachsen: Rabbiner Gábor Lengyel und Yazid Shammout, Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde Hannover, haben den Niedersächsischen Verdienstorden erhalten.
Es handle sich um »eine doppelte Ehrung, über die ich mich ganz besonders freue«, betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Auszeichnung Ende vergangener Woche. Beide Empfänger »haben sich über viele Jahre in besonderer Weise für den interreligiösen Dialog zwischen Juden und Muslimen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt eingesetzt«, so Weil. Gerade in der aktuellen Situation seien Lengyel und Shammout mit ihrem Handeln »ein Vorbild für Dialog und Verständigung, die unsere Demokratie so dringend braucht.«
DIALOG Seit langer Zeit herrscht zwischen der Jüdischen und der Palästinensischen Gemeinde in Hannover ein reger Dialog. Friedensappelle für den Nahen Osten haben die Gesprächspartner bereits geäußert.
»So etwas gibt es sonst nirgends auf der Welt«, erklärte Weil nach einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen, »und es macht mich stolz, dass es bei uns möglich ist, solche Partnerschaften zu schmieden.« Die Preisträger arbeiteten für Völkerverständigung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie.
Gábor Lengyel selbst sagte im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen, er sei generell »etwas skeptisch«, wenn es um Orden gehe, habe sich jedoch dennoch gefreut. Viele Freunde seien bei der Ehrungszeremonie im Haus der Landesregierung dabei gewesen. Mit Yazid Shammout bestehe ein persönliches Verhältnis, das im interkulturellen und interreligiösen Dialog entstanden sei.
KRITIKER Der jüdisch-muslimische Dialog in Hannover begann nach Angaben von Rabbiner Lengyel »vor etwa 10 Jahren«. Zunächst fing er an »mit einer muslimischen Freundin, die Theologin ist«, den Koran und die Thora zu lesen »und zu besprechen«. Dieser Austausch sei möglich geworden, da zwei Themen ausgeklammert worden seien, nämlich die Schoa und »das Politische«.
Um diese Themen diskutieren zu können, »muss der Moment reif sein«, so der in Budapest geborene Rabbiner. Er fügte hinzu, er sei ein »harter Kritiker« der Tendenz in Israel, »immer wieder rechts zu wählen.«
Nach der Ehrung sei er »von unserem palästinensischen Freund« mit Familienmitgliedern und Freunden in ein syrisches Restaurant eingeladen worden, sagte Gábor Lengyel. So sei der Anlass gefeiert worden.
FLUCHT Für Rabbiner Lengyel ist es nicht die erste Ehrung dieser Art. Im Jahr 1993 erhielt er das Niedersächsische Verdienstkreuz, diesmal von Gerhard Schröder, einem von Weils prominenten Vorgängern.
Gábor Lengyels Vater Márton war im Verband der Jüdischen Gemeinden Ungarns aktiv, als die Wehrmacht das Land überfiel. Seine Mutter Janka, geborene Stern, wurde ins KZ Ravensbrück deportiert und starb auf dem Weg von dort nach Dachau in einem Viehwaggon.
Der heutige Rabbiner, sein Vater und seine Geschwister überlebten den Holocaust. In den 1950er-Jahren beschloss Lengyel, allein aus dem kommunistischen Ungarn zu fliehen. Über Österreich ging es nach Israel.
Als Mechaniker diente er in der israelischen Armee, bevor er in der Industrie in Tel Aviv arbeitete und 1965 nach West-Deutschland umzog, wo er als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung an der Technischen Universität in Braunschweig studierte.
AUFBAU Ende der 1970er-Jahre wurde Gábor Lengyel sowohl im jüdisch-christlichen als auch im jüdisch-muslimischen Dialog aktiv. Er trug zum Aufbau der Jüdischen Gemeinde Braunschweig bei und war lange in deren Vorstand. Auch der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gehörte er an.
Schließlich war er Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover. Im Jahr 2011, im Alter von 70 Jahren, promovierte er. Das Thema: »Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn«. Auch als Lehrbeauftragter an der Leibniz Universität Hannover ist Gábor Lengyel weiterhin aktiv, im Alter von 81 Jahren.