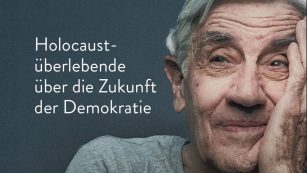Rabbiner Chaim Rozwaski ist tot. Der ehemalige Gemeinderabbiner verstarb am Dienstag in Berlin. Er soll seine letzte Ruhestätte in Israel finden.
Das teilte Rabbiner Yehuda Teichtal von der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin mit. Er würdigte den Verstorbenen am Mittwoch in seiner Synagogenansprache.
Rozwaski wurde 1935 (oder 1933 - die öffentlich zugänglichen biografischen Angaben sind unterschiedlich) in einem Dorf im heutigen Weißrussland geboren. Er überlebte die Schoa, indem er in Wäldern und auf Bauernhöfen versteckt wurde. Viele seiner unmittelbaren Familienangehörigen wurden ermordet. 1946 kam er im Rahmen eines Programms für jüdische Waisenkinder nach Kanada. Er besuchte das Hebrew Theological College in Skokie, Illinois, und promovierte in Baltimore im Fach Talmudisches Recht. Unter anderem war er Rabbiner in Peekskill, New York, und in Orlando, Florida.
1998 kam er als Leiter des neu gegründeten Jüdischen Lehrhauses nach Berlin. Die Einrichtung der Ronald-S.-Lauder-Foundation bildete in der Rykestraße am Prenzlauer Berg Lehrer und »Multiplikatoren« für jüdische Einrichtungen aus.
Später wurde er Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in der Synagoge Pestalozzistraße. Es war eine besondere Konstruktion, in der er als orthodoxer Rabbiner in einer liberalen Synagoge amtierte. 2006 sagte er unserer Zeitung einmal, dass es in der Gemeinde Missverständnisse gebe, die dazu führten, dass gelegentlich das Ziel aus den Augen verloren werde. »Man sollte sich mehr auf Projekte konzentrieren und nicht nur auf Ideen.« Das Wichtigste sei: Jüdischkeit müsse im Mittelpunkt stehen.
Die Tätigkeit als Gemeinderabbiner endete 2008 nach einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung. Danach zog ein Teil der Beterschaft mit ihm in die Charlottenburger Grolmannstraße, wo sie die Synagoge »Lev Tov« eröffneten. Dort organisierte er mit vielen Helfern unter anderem die wöchentliche Ausgabe koscherer Lebensmittel an Bedürftige. Damals sagte er der Tageszeitung: »Es ist ein Skandal der westlichen Zivilisation, dass es Obdachlose und Hungernde gibt.«
Er erzählte öfters, dass es ihm nicht leichtgefallen sei, nach Deutschland zu kommen
Als die Räume dort zu klein wurden, folgte der Umzug ans Roseneck. Dort war Platz für eine Synagoge, eine Bibliothek, ein Spielzimmer, Büros, einen Kidduschraum, eine Bäckerei und ein kleines Café. Damals erklärte der Rabbiner in der Jüdischen Allgemeinen: »Wir sind eine Synagoge nach klassisch-orthodoxem Ritus, in der alle jüdischen Menschen willkommen sind.« Träger sei die »Berlin Yeshiva Academy – Institut für den Religiösen Dialog«. Die Einrichtung habe sich laut ihrer Website dem »interreligiösen und interkonfessionellen Dialog in Freiheit und gegenseitiger Achtung sowie der Pflege der jüdischen Tradition, der Förderung Studierender und der Hilfe bedürftiger Menschen« verschrieben.
Der Name der Synagoge »Lev Tov« (Gutes Herz), deren Minjan später einen weiteren Ort für ihre Gottesdienste im Grunewald fand, sei nicht zufällig gewählt worden. Er sollte Programm, Anspruch und Ansporn für alle sein. Wer Sorgen habe oder zu seinen jüdischen Wurzeln zurückfinden wolle – jedem solle geholfen werden, betonte Rozwaski stets.
Er erzählte mehrfach, dass es ihm nicht leichtgefallen sei, mit seiner Frau Roberta nach Deutschland zu kommen. Die gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik bereitete ihm Sorgen. Bereits 2002 beklagte er öffentlichen einen zunehmenden Antisemitismus.
Rabbiner Yehuda Teichtal berichtete, dass er Rabbiner Rozwaski noch kurz vor dem Sukkotfest besucht habe. »Und dabei sagte er mir, dass es für ihn eine große Freude und Genugtuung sei, dass der von ihm begründete Minjan im Grunewald nun von meinem Sohn, Rabbiner David Teichtal, fortgeführt wird.« ddk