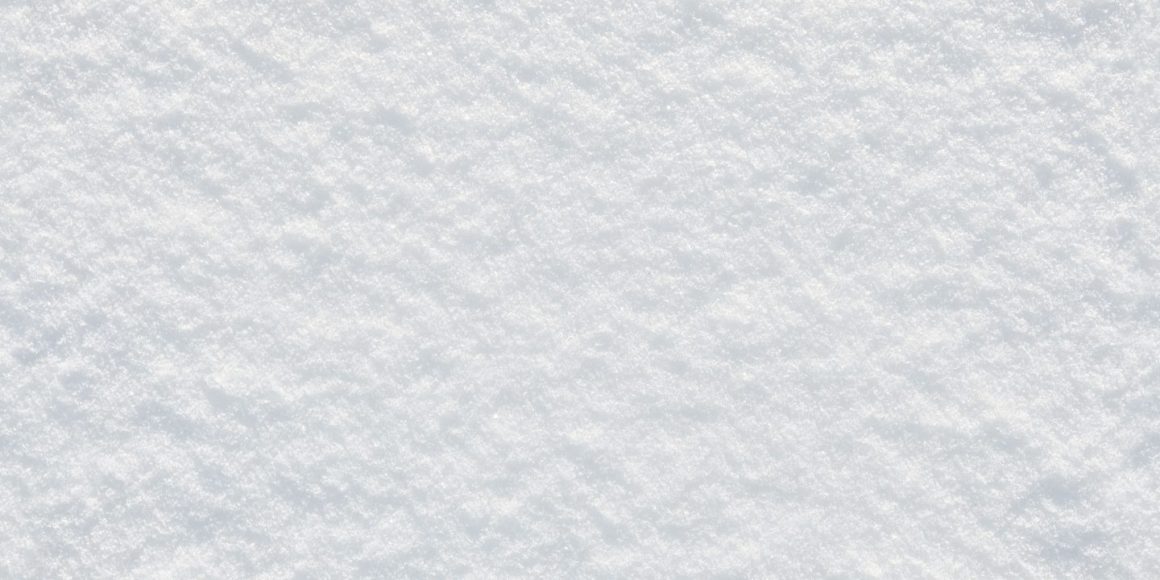Im Talmudtraktat Taanit sagt der Amoräer Raba: »Schnee ist für die Berge so wohltuend wie fünffacher Regen für die Erde« (3b). Im Nahen Osten, wo das Wasser nicht in Fülle vorhanden ist, war eine solche Aussage ein besonders großes Lob des Schnees.
Aber warum interessieren sich unsere Weisen für Schnee? Wäre Regen nicht schon genug?
Gebirgskette Wie wir der jüdischen Tradition entnehmen können, hat Schnee tatsächlich viele Bedeutungen. Raschi erklärt, Schnee krönt das Land Israel. Die gewaltige Gebirgskette des Antilibanons, im Norden des Heiligen Landes gelegen (heute im Libanon und in Syrien sowie dem Hermon-Berg auf den Golanhöhen), verdankt ihren emoritischen Namen, »Senir«, dem Umstand, dass auf ihren Gipfeln viel Schnee liegt.
Zusammen mit der anderen großen Gebirgskette, dem majestätischen Libanon (von Hebräisch »lawan«, »weiß«, was auch auf Schnee hindeutet), stellen beide Israels höchstgelegenen Punkt dar.
Je höher ein Ort liegt, desto mehr G’ttesnähe bildet er im Tanach symbolisch ab. Nicht umsonst wurde die Tora den Israeliten auf einem Berg gegeben. Der Schnee, das klimatische Sinnbild der Höhe, ist also auch ein Zeichen für Erhabenheit. Der Libanon steht daher in einigen prophetischen Reden auch für den verschollenen Garten Eden (Jecheskel 28,13).
Symbolik Aufgrund dieser Symbolik heißt es im Midrasch (Pirkej de-Rabbi Elieser 3,8), unter dem transzendenten Thron G’ttes liege Schnee. Dieser metaphorische Schnee deutet bildlich an, dass der Ewige noch viel erhabener ist als die höchsten schneebedeckten Berge der Erde.
Bemerkenswert ist, dass laut demselben Midrasch (und dem Propheten Jecheskel 1, 22 und 27) die Kälte des Schnees weiter oben am Thron von Feuer flankiert wird. Starke Kälte und Hitze sind parallele Metaphern für die Macht und Unnahbarkeit G’ttes.
Beide Seiten, der Schnee und das Feuer, können den Menschen nämlich gefährlich werden, falls sie sich durch ihre Taten vom Ewigen entfernen.
So lautet etwa eine Meinung im Midrasch Tanchuma, Re’eh 13: »Die Strafe der Bösewichte im Gehinom dauert zwölf Monate. Sechs davon sitzen sie in großer Hitze, sechs weitere in großer Kälte. Zu Beginn bringt sie der Heilige, gepriesen sei Er, in die Hitze, wo sie sagen werden: ›Dies ist das (feurige) Gehinom des Ewigen.‹ Danach führt Er sie in den Schnee, wo sie sagen werden: ›Dies ist die Kälte des Ewigen.‹ In der Hitze klagen sie ›hah‹, in der Kälte ›waj.‹«
Sühne Aus diesem Grund haben sich einige überfromme jüdische Gelehrte des mittelalterlichen Deutschland, sobald sie fühlten, dass sie gesündigt hatten, lieber schon unmittelbar in den kalten (diesweltlichen) Schnee gesetzt, um Sühne für ihre Vergehen zu erlangen und sich durch drastische Erziehungsmethoden von künftigen Verfehlungen fernzuhalten.
Diese Praktiken wurden allerdings später von vielen moralischen Autoritäten der Tradition kritisiert, unter anderem vom Ramchal, dem italienischen Rabbiner Mosche Chaim Luzzatto (1707–1746).
Dennoch bleibt es dabei, dass Schnee das Potenzial hat, g’ttlichen Zorn und große Gefahren auszudrücken. So sagt der Ewige, es sei Schnee, »den Ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag der Schlacht und des Kampfes« (Ijow 38,23).
Veranschaulichend hören wir diesbezüglich über Benajahu ben Jehojada, einen der besten Krieger von König David, dass er gleich zwei große Gefahren bezwang: »Er erschlug einen Löwen in der Grube am Tage des Schnees« (2. Schmuel 23,20).
Trotz alledem symbolisiert Schnee nicht nur schlechtes menschliches Verhalten, sondern auch dessen gute Kehrseite. Schnee steht aufgrund seiner reinen weißen Farbe auch für die innere Reinheit. So heißt es in Jeschajahu (1,18): »Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, mögen sie weiß wie Schnee werden.«