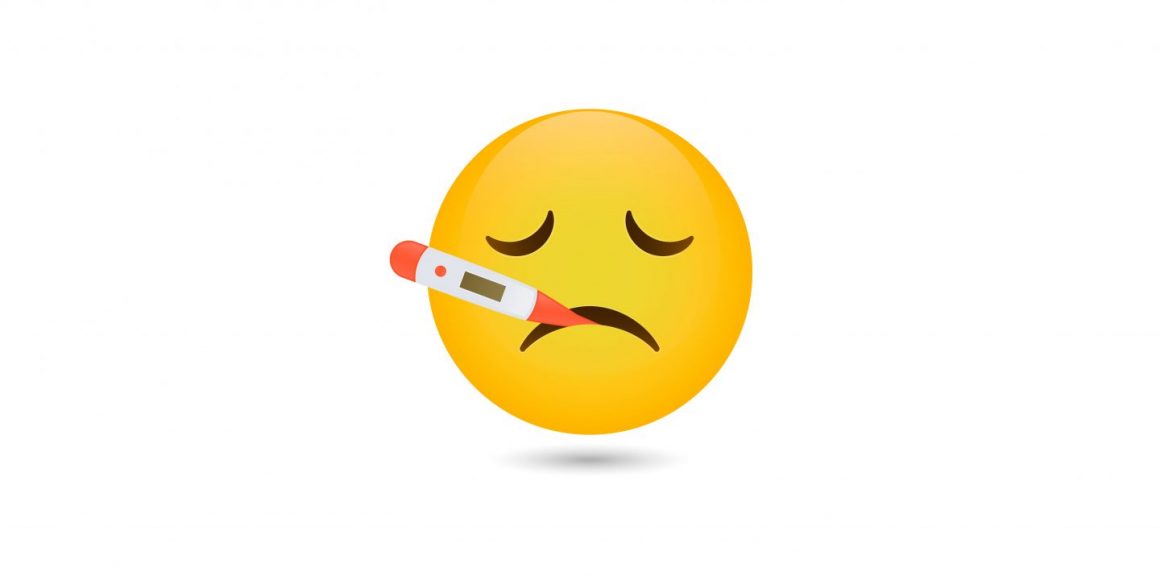Niemand will krank sein. Auch wenn sich ein Schüler einmal krankmeldet, um sich vor einer Arbeit zu drücken, will er doch nicht wirklich unpässlich sein. In diesem Sinne erkennt die Tora die Ängste der Menschen und verspricht uns das, was wir hören möchten: »All die Krankheiten, die Ich über Ägypten gebracht habe, tue Ich dir nicht an, da Ich dein G’tt, dein Heiler, bin« (2. Buch Mose 15,26).
Nach dem Auszug aus Ägypten sind immer noch traumatische Erlebnisse in unserer Erinnerung. Wir haben gesehen, wie die Ägypter unter den zehn Plagen litten – so etwas wollen wir nicht erleben.
Was aber ist der Sinn dieses Versprechens? Grundsätzlich gibt es keine kostenlosen Geschenke. Schon davor wird erklärt: »Wenn ihr auf die Stimme des Ewigen, eures G’ttes, hört und was recht ist in Seinen Augen tut und auf seine Gebote hört und alle seine Satzungen haltet«, dann heilt Er euch und erlöst euch von Krankheiten.
BITTER Als das Volk nach Mara kam und Wasser suchte, wurde dort nur bitteres und ungenießbares Wasser gefunden. Der Wassermangel in der Wüste war unerträglich, und das Volk beschwerte sich und rebellierte. Haschem, der Ewige, zeigte Mosche ein Stück Holz, Mosche nahm es und warf es ins Wasser. Daraufhin wurde das Wasser süß, und man konnte es trinken. Laut dem Midrasch war das Holz nicht süß, sondern sehr bitter. Es ist uns allen klar, dass nicht das Holz das Wasser gesüßt hat.
Es geschehen Dinge in der Welt, die sich jeder Logik entziehen. So ist es auch im Leben eines Menschen. Manchmal kommen Zeiten, die wir nicht verstehen können. Alles scheint sehr bitter zu sein. Man sucht nach Wegen, um herauszukommen, aber auch das scheint nicht hilfreich zu sein, sondern ist sogar noch bitterer.
So etwas passiert oft mit einem kranken Menschen. Er sucht ein gutes Mittel – doch die Angebote und Methoden der Medizin machen es ihm noch schwerer: Operationen, G’tt behüte, Medikamente und anderes mehr. Der kranke Mensch fürchtet, dass er in seinem Leben nichts Gutes mehr erleben wird. Doch alles führt letztendlich zum Guten. Jetzt ist es schwer, aber es wird besser sein. Es lohnt sich, jetzt noch etwas Schmerz zu erleiden, weil es danach besser sein wird.
Wir sollten uns also immer vor Augen halten, dass alles, was G’tt macht, letztendlich zum Besten ist − auch wenn wir es nicht immer gleich erkennen können.
Es war G’ttes Wille, das Volk zu belehren, dass das Bittere nicht immer und nicht nur schlecht ist. Haschem verspricht uns, laut dem Midrasch, dass, falls Er uns Krankheiten schickt, diese nicht bedeutungslos sind. Durch die Leiden, die wir ertragen müssen, will Er uns von unseren Fehlern und von unseren Sünden reinigen und befreien.
Laut dem Talmud sind der Husten und die Erkältung die einzigen Krankheiten, an denen der Mensch selbst schuld ist (Ketubot 30a) – man kann doch die Fenster schließen oder sich besser anziehen! Alle weiteren Krankheiten sind von Haschem bestimmt. Dies erklärt einiges.
Wie können uns die Ge- und Verbote gegen Krankheiten helfen? Eine Erklärung gibt uns Ibn Esra (1089–1167): »Ihr habt in Ägypten gesehen, was Menschen passiert ist, die auf Mich nicht gehört haben. Hört auf Mich, damit euch nicht das Gleiche passiert.« Dies ist eine gute Empfehlung an uns, damit wir gesund bleiben.
»G’tt warnt, aber bestraft nicht!«, werden manche sagen. Der Grund, warum es Krankheiten überhaupt gibt, ist, die Menschen zu lehren, wieder wach zu sein und auf ihre Wahrnehmung aufzupassen. Krankheiten sind Teil eines Erziehungsprozesses. Doch den kann man sich sparen: Wer sich an den Ge- und Verboten orientiert, muss nicht noch mehr erzogen werden. Haschem braucht dann den Menschen nicht mehr zu warnen und sowieso nicht zu bestrafen. Dies sagte Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888). »Alle Krankheiten und Naturkatastrophen haben einen moralischen Zweck, der das hartnäckige Herz erweichen soll, damit der Mensch auf die guten g’ttlichen Wege zurückkehrt.«
TRIEB Der Mensch braucht Hilfe, um die guten Wege einzuschlagen. Idealerweise wählt der Mensch den moralischen Weg, weil er weiß und versteht, dass es seinen moralischen Erwartungen entspricht. Jemand, der vor einer Entscheidung steht, ob er etwas Unmoralisches unternehmen will und seinen Trieb nicht mit der Kraft des eigenen Verstands beherrschen kann, muss manchmal durch andere Mittel auf die richtigen Gedanken gebracht werden, um dadurch auf dem guten Weg zu bleiben. Selbst das Wissen davon, dass es ihn körperlich beeinträchtigen kann, hält die Person davon ab, schlechte Taten zu begehen (Rav Kook, Ein Aja, Schabbat B, 202).
Der Nutzen von Krankheiten ist ersichtlich, wenn die Menschen sich nicht richtig verhalten. Falls die Menschen Tschuwa machen, ist es nicht mehr nötig. Gerade das Versprechen, dass wir nicht mehr unter Krankheiten leiden werden, verschärft die Bedeutung einer Krankheit.
Wie eingangs geschrieben, lesen wir in unserem Wochenabschnitt: »… da ich G’tt, dein Heiler, bin« (2. Buch Mose 15,26). Dem können wir entnehmen, dass nach G’ttes Plan niemand krank sein oder werden soll. Vielmehr sollen wir auf unsere Gesundheit achtgeben und auf ärztliche Empfehlungen hören. Doch wir müssen begreifen, dass uns Zeiten von Krankheit und Pandemie zum Nachdenken über Moral aufrufen. Viele moralische Regeln helfen uns, auch in solchen Zeiten stark zu bleiben und nicht noch Schlimmeres zu erleben.
Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Frankfurt/Main und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).
inhalt
Der Wochenabschnitt Beschalach erzählt, wie die Kinder Israels auf der Flucht vor dem Pharao und seinen Truppen trockenen Fußes das Schilfmeer durchquerten. Es öffnete sich vor ihnen und schloss sich hinter ihnen wieder, sodass die Männer des Pharaos in den Fluten ertranken. Danach beginnt der eigentliche Weg Israels durch die Wüste. Es wird berichtet, wie der Ewige die Menschen mit Manna und Wachteln versorgt und sie auffordert, Speise für den Schabbat beiseitezulegen. Dennoch fehlt es an Wasser, und die Kinder Israels beschweren sich bei Mosche. Der lässt daraufhin Wasser aus einem Felsen hervorquellen.
2. Buch Mose 13,17 – 17,16