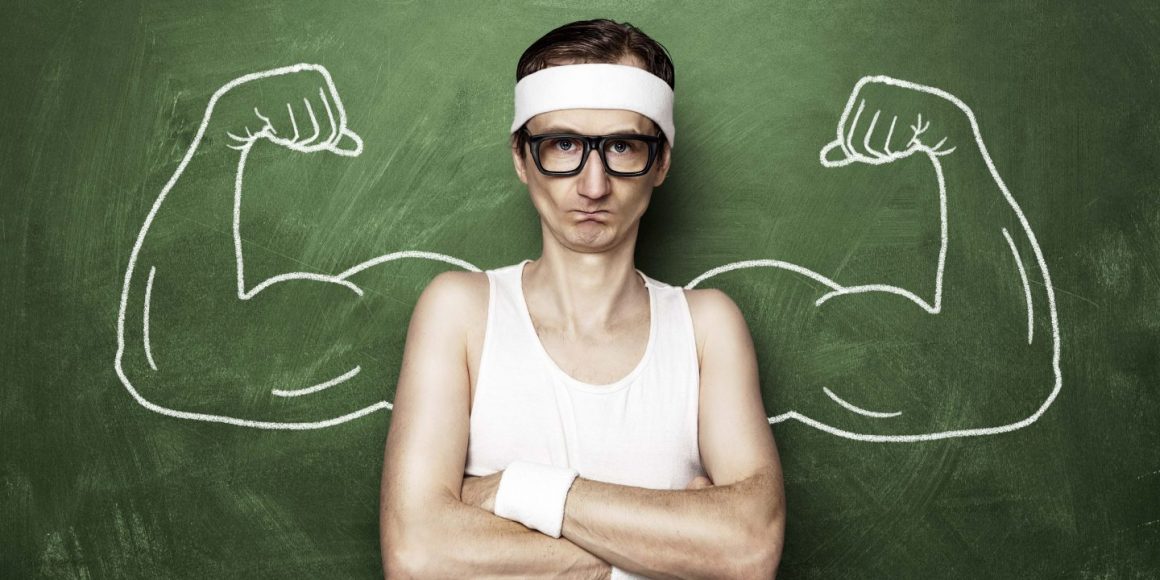Unser Wochenabschnitt beschreibt die Einweihung des Mischkan, des Stiftzelts. Mosche instruiert seinen Bruder Aharon mit den Worten: »Tritt näher zum Altar hin und vollziehe dein Sünden- und dein Brandopfer und vollbringe Sühne für dich und das Volk« (3. Buch Mose 9,7).
Die Formulierung »tritt näher« und die Tatsache, dass Aharon wiederholt aufgefordert werden muss, gibt laut Raschi (1040–1105) Auskunft über Aharons Befinden. Raschi meint, Aharon habe sich geschämt, und Mosche fragte ihn daraufhin: »Warum schämst du dich? Es ist nämlich hierfür, wofür du auserwählt wurdest!«
»Das, was du für deine größte Schwäche hältst, ist letztendlich deine größte Stärke!«
Heuchler Der frühere britische Oberrabbiner Jonathan Sacks vermutet, dass Aharon die erneute Aufforderung von seinem Bruder nicht aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins benötigte. Vielmehr fühlte er sich seines Amtes nicht würdig. Er betrachtete sich selbst als Heuchler, der nicht das Recht hatte, diese Aufgabe zu erfüllen.
Das Errichten des Mischkan folgte direkt aus der Sünde vom Goldenen Kalb. Das Stiftszelt war die kollektive Sühne dieses gravierenden Vergehens.
Aharon hatte dabei keine unwesentliche Rolle gespielt. Er war es, dessen Handeln dazu geführt hatte, dass das Goldene Kalb errichtet wurde. Sein Bruder Mosche machte ihm deshalb später Vorwürfe. Dies war der Grund, warum Aharon zögerte. Er war genauso schuldig wie alle anderen im Volk und fragte sich deshalb, warum gerade er die Leitung der Sühne übernehmen sollte.
Mosche lehrte Aharon eine wichtige Lektion.
Genau das ist der zentrale Punkt. Es ist die Aufgabe des Hohepriesters, in diesem Fall also Aharons, seinen Beitrag zu leisten, damit die Sünden der Menschen gesühnt werden. Wer ist da besser geeignet als jemand, der selbst gesündigt und darunter gelitten hat und nun den Drang verspürt, es wiedergutzumachen?
Mosche lehrte Aharon eine wichtige Lektion: »Das, was du für deine größte Schwäche hältst, ist in der Rolle, die du gleich einnehmen wirst, letztendlich deine größte Stärke!«
Oft ist ein Arzt, der selbst einmal krank war, der bessere Arzt, da er das Leiden und die Schmerzen seiner Patienten aus eigener Erfahrung kennt. Er kann sich besser in sie hineinfühlen. Ist es da nicht sinnvoll, einen Hohepriester einzusetzen, dessen Emotionalität aufgrund seiner Lebensgeschichte am intensivsten sein wird?
Obwohl Mosche einen Sprachfehler hatte, verlangte Gott von ihm, in Seinem Namen zu sprechen.
Sprachfehler Rabbiner Sacks entwickelt den Gedanken weiter: Auch Mosche erlebte etwas Ähnliches. Obwohl er einen Sprachfehler hatte, verlangte Gott von ihm, in Seinem Namen zu sprechen. Mosche haderte damit, denn er befürchtete, der Pharao und das jüdische Volk würden ihn aufgrund seines Sprachfehlers nicht respektieren.
Auch hier wird eine Schwäche schließlich zu einer Stärke. In der Weltgeschichte waren die großen Anführer, Diktatoren oder Tyrannen rhetorisch sehr begabt. Einem von Gott Gesandten, der aufgrund seines Sprachfehlers die Rolle gar nicht annehmen wollte, kann nicht unterstellt werden, dass er dies aus persönlichem Machthunger heraus angestrebt hätte. Es war für alle Beteiligten klar: »Er ist hier, weil er hier sein muss. Er redet, weil es ihm befohlen wurde, und wir sollten ihm zuhören, da es offensichtlich Gottes Wort ist.«
Wieder wurde eine Schwäche in eine Stärke verwandelt. Mosche und Aharon mussten gegen ihr Naturell kämpfen. Nur dadurch gelang es ihnen, ihre Defizite in etwas Göttliches umzuwandeln – denn der Mensch hat die Wahl zwischen der Resignation und dem persönlichen Triumph.
Mosche und Aharon mussten gegen ihr Naturell kämpfen.
Basierend auf dem Ansatz von Rabbiner Sacks lässt sich etwas Fundamentales lernen: Wenn mich mein eigenes Unvermögen daran hindert, etwas Bestimmtes zu tun, dann habe ich auch keine persönlichen Ambitionen, die Tat zu vollbringen. In dem Moment, wo ich aus persönlichen Gründen etwas nicht tun möchte, gibt es, auch wenn ich es trotzdem tue, keine persönliche Motivation mehr. Ab diesem Zeitpunkt ist die Tat rein göttlich motiviert.
Streben Wenn wir ehrlich und reflektiert darauf schauen, wie wir religiöse Gebote ausführen, erkennen wir hinter unserem Tun persönliche Elemente, Bestrebungen oder Neigungen. Natürlich geht es uns auch darum, den Willen Gottes zu erfüllen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, mit einem ehrlichen Blick die persönlichen Elemente zu betrachten.
Gehe ich zum Sederabend, weil meine Eltern das schon immer taten und ich ansonsten ein schlechtes Gewissen hätte? Spende ich, weil ich mich danach gut fühle? Gehe ich zum Gebet, weil es ein schönes Gefühl ist, einer Gemeinschaft anzuhören? Gibt mir das Erfüllen der detaillierten Gebote Sicherheit? Kann ich mich aufgrund meines Wissens behaupten oder gar etwas Macht ausüben? Erfülle ich das Gebot aus einem angelernten »Gehorchen-und-Befolgen-Schema« heraus oder aus Liebe zu Gott?
Ziel dieser Auflistung ist nicht, das Erfüllen der Gebote zu entwerten. Vielmehr geht es darum, sich selbst bewusst zu machen, was beim Halten der Gebote sonst noch für Motivationen in einem Menschen schlummern.
Wissen wir denn, ob Mosche und Aharon nach der Überwindung ihrer Qual nicht auch stolz gewesen sind auf sich?
All diese persönlichen Elemente fallen weg, sobald das Negative (beispielsweise die eigene Unzulänglichkeit oder Unannehmlichkeit) stärker ist als das Positive. Schafft man es aber trotzdem, dann war die primäre Motivation wohl eine rein göttliche. »Ich tue das, weil es mich Gott näherbringt und weil es meinem spirituellen Wachstum dient.« Diese Botschaft lehren uns die beiden bestandenen Charakterprüfungen von Mosche und Aharon.
Man könnte nun argumentieren, dass nach der Vollendung der Tat möglicherweise Stolz aufkommt, was nicht göttlich, sondern ausgesprochen menschlich ist. Es ist ja aber nicht verboten, persönliche Elemente zu besitzen und auch einzusetzen. Doch für das eigene spirituelle Wachstum ist es existenziell, sich dessen bewusst zu werden, damit die reine göttliche Motivation hervorgehoben werden kann. Und überhaupt: Wissen wir denn, ob Mosche und Aharon nach der Überwindung ihrer Qual nicht auch stolz gewesen sind auf sich?
Der Autor ist Psychologe in Osnabrück. Er hat an Jeschiwot in Jerusalem und in England studiert.
Inhalt
Der Wochenabschnitt Schemini schildert zunächst die Amtseinführung Aharons und seiner Söhne als Priester sowie ihr erstes Opfer. Dann folgt die Vorschrift, dass die Priester, die den Dienst verrichten, weder Wein noch andere berauschende Getränke trinken dürfen. Der Abschnitt listet auf, welche Tiere koscher sind und welche nicht, und er erklärt, wie mit der Verunreinigung durch tote Tiere umzugehen ist.
3. Buch Mose 9,1 – 11,47