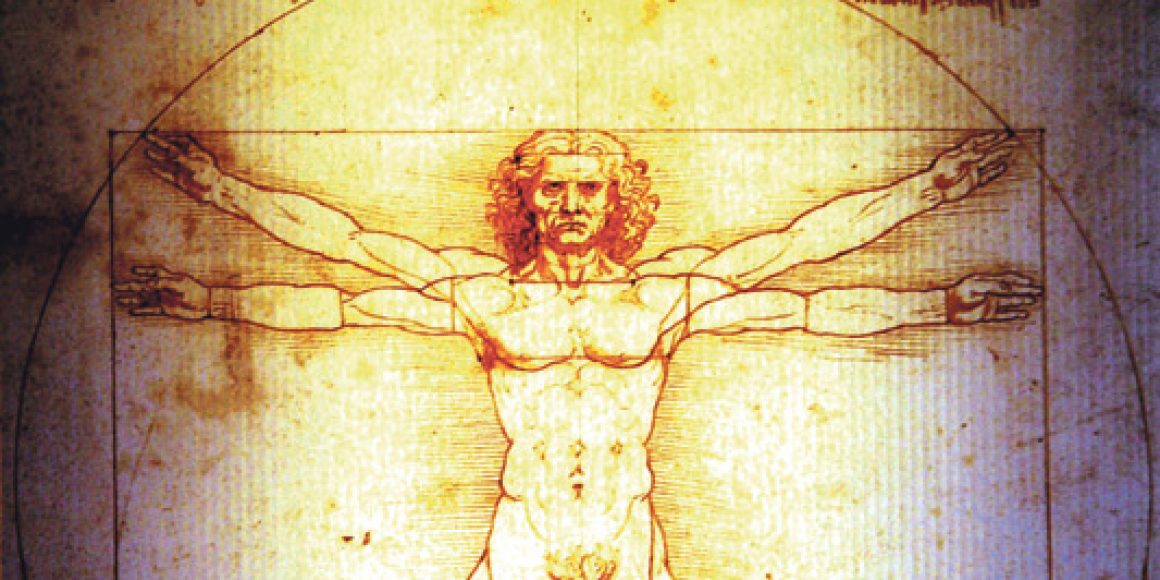In der Parascha dieses Schabbats erinnern wir uns an die Hauptintention der jüdischen Tradition, der größtmöglichen Annäherung an unseren Schöpfer: »Denn ich bin der Ewige, euer G’tt: So heiligt euch, dass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig« ( 3. Buch Moses 11,44). Weil dieses Ziel nur in enger Verbindung mit G’tt erreicht wird, erfleht Aharon den Segen des Ewigen für das Volk. Unsere Weisen fragen sich, welche Worte er wohl benutzte und antworten, dass Aharon die Worte des Birkat Kohanim sprach, des Priestersegens. Wir erfahren, dass Mosche und Aharon gemeinsam nochmals das Volk segneten, diesmal gemäß unserer Chachamim mit Worten aus Psalm 90: »Werde uns Ewiger, unser G’tt, das Beglückende: Das Tun unserer Hände gründe auf uns, und das Tun unserer Hände stelle Du fest!«
Befreiung Setzen wir beide Brachot, diejenige Aharons und die Mosches, in einen Kontext, so stellen wir fest, dass Heiligkeit, die größtmögliche Vervollkommnung des Menschen, durch einen Prozess der eigenen Befreiung erreicht wird, wie ihn Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) in seinem Kommentar umschreibt: Das von G’tt für Israel beschiedene Glück bestehe in der Selbstständigmachung. Damit verbunden ist die freie Verfügung über das Tun unserer Hände, das zur Unabhängigkeit von anderen Menschen und zur Orientierung an der Tora führt.
In der Heiligkeit liegt das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Gesetz, ein Grundprinzip jüdischer Lebensauffassung. In manchen Gemeinden war und ist es Brauch, jeder Parascha einen Psalm zuzuordnen. Der unserer Parascha zugeordnete Psalm 128 erinnert uns daran, dass das Ideal der Selbstvervollkommnung nur über die »Keimzelle« des Judentums, das jüdische Haus und die jüdische Familie, erreicht wird. Sie schlägt sich in den Geboten nieder, die das Familienleben betreffen (Taharat Mischpacha) sowie in der Kaschrut, den Speisegesetzen. Durch sie wird die Weitergabe der Werte und Inhalte unserer Tradition gesichert.
In seinem Kommentar verweist Rabbiner Hirsch auf einen weiteren bedeutsamen Punkt, der zum Ideal der Selbstvervollkommnung gehört, nämlich auf die Ausrichtung nach Zion, die insbesondere in der Haftara dieses Schabbats zum Tragen kommt. »Aus Zion quillt ihm (dem g’ttesfürchtigen jüdischen Mann) die Kraft, und auf Jerusalems Wohl blickt er sein Leben lang hin, Beitrag zum Wiederaufbau zu werden, ist der Gedanke, der sein Leben erfüllt.«
Bewahrung Selbstständig zu werden und sich an der Tora zu orientieren, Selbstvervollkommnung sowie die Ausrichtung auf Jerusalem und Zion bilden Meilensteine zum Tikkun Olam. Die Bewahrung von Taharat Mischpacha und Kaschrut in der Familie sind das Fundament. An dieser Stelle zeigt sich uns die Tora wiederum als das große Buch der Erziehung des Menschen. Das Ziel der Speisegebote wird in der Aufforderung G’ttes an uns Menschen deutlich genannt: »Strebt nach Heiligkeit, und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« Erreicht wird dieses große Ziel durch Unterscheidung, Hawdala, zwischen Heiligem und Unheiligem, zwischen Reinem und Unreinem.
Rabbiner Joseph Herman Hertz (1872–1946) bemerkt dazu, das bloße Streben nach Heiligkeit mache an sich schon heilig. Bemerkenswerterweise findet dieser Gedanke seine Fortsetzung und Begründung im fortlaufenden Text, in dem es heißt, wir sollen uns nicht durch das auf dem Lande kriechende Gewürm verunreinigen, denn es ist G’tt, der uns aus dem Land Mizrajim heraufgebracht hat. Und so lautet die abschließende Mahnung: »Seid heilig, denn ich bin heilig« (3. Buch Moses 11,45).
Triebleben In allen Generationen diskutierten Gelehrte die Frage, ob die Reinheitsgebote der Tora Religionsgesetz oder hygienische Vorschriften seien. In einem 1930 verfassten, heute immer noch aktuellen Essay schreibt der frühere Altonaer Oberrabbiner Joseph Carlebach (1883–1942) über die Bedeutung der ganzheitlichen Sicht des Menschen, der in den Prozess der Vervollkommnung hineingestellt ist: »In der Eingrenzung und Regelung des Trieblebens liegt eine Heiligung, das heißt, seine Einstimmung in den Gesamtchorus aller Funktionen des Menschen, weil durch solches Speisegesetz, das erlaubt und verbietet, jeder Bissen das Siegel des G’ttgewollten erhält, darum sollt ihr euch der verbotenen Speisen enthalten.«
Erziehung Der Sinn von Kaschrut und Taharat Mischpacha liege in der Vervollkommnung, so Carlebach. Religion »ist Erziehung, Konzentration aller Äußerungen des Menschen auf eine höhere Aufgabe, ›die Einheit‹ des Menschen und seine Einigung.« In diesem Sinne haben unsere Weisen alle Gesetze des Judentums verstanden und fortgebildet.
Hier finden wir den Anknüpfungspunkt an Zion: Unsere Rabbinen haben vor dem Brotgenuss, der Hauptnahrung des Menschen, eine Händewaschung in derselben Form vorgeschrieben, wie die Kohanim im Beit Hamikdasch die Hände übergossen. Die Rabbinen begründeten ihren Entschluss damit, dass der Esstisch dem Opferaltar im Tempel entspreche. Ebenso setzten sie das Händewaschen am Morgen und nach der Verrichtung der menschlichen Grundbedürfnisse an, damit wir uns an unser Menschsein erinnern.
Heiligung, das Streben nach Vollkommenheit, ist die beste Hygiene, oder, in der Sprache Rabbiner Josef Carlebachs formuliert: »Das ist die Medizin der Bibel«. Ziel der Tora ist es, die Theorie des g’ttlichen Gesetzgebers zur lebendigen Tat zu machen. Die Tora, die Quelle des Lebens, bildet den Prüfstein für unser Leben. Sie erinnert uns an die Verantwortung, die wir Menschen in dieser Welt tragen: Verantwortung hinsichtlich der Heiligkeit des Lebens, Erinnerung an die Bedeutung der Lebenserhaltung.
Der Autor ist Leiter des religiösen Erziehungswesens der IKG München.
Inhalt
Der Wochenabschnitt Schemini schildert zunächst die Amtseinführung Aharons und seiner Söhne als Priester sowie ihr erstes Opfer. Dann folgt die Vorschrift, dass die Priester, die den Dienst verrichten, weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen dürfen. Der Abschnitt listet auf, welche Tiere koscher sind und welche nicht, und er erklärt, wie mit der Verunreinigung durch tote Tiere umzugehen ist.
3. Buch Moses 9,1 – 11,47