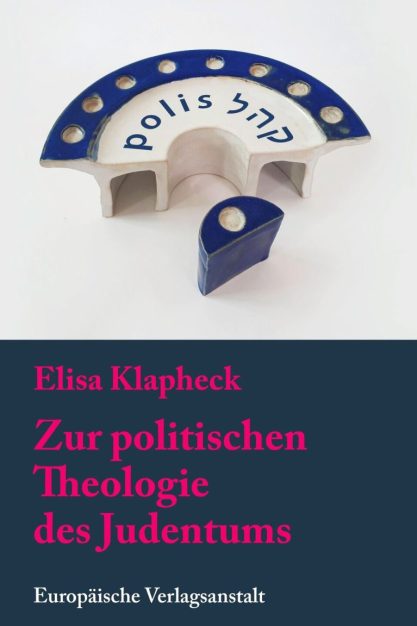Das neue Buch von Elisa Klapheck, Rabbinerin in Frankfurt und Professorin für Jüdische Studien in Paderborn, trägt einen lapidaren Titel. Zur politischen Theologie des Judentums hat nach heutigen Vorstellungen eher die Qualität eines erläuternden Untertitels. Im Kontext der philosophisch-theologischen Tradition jedoch, an die sich dieses Buch anschließt, verweist die Formulierung seines Titels auf das Grundsätzliche seines Themas.
Vergleichbar ist der Titel etwa mit Spinozas Theologisch-politischem Traktat, in dem grundsätzlich neue Perspektiven des Religiösen aufgezeigt werden. Elisa Klapheck geht es ebenfalls um die elementare Frage, wie der Mensch heute mit Gott lebt und wie er sich aufgrund seines neuen Verständnisses von Theologie mit der Tradition verbinden kann.
anspruch Klaphecks Buch ist keine rabbinische Schrift, sondern das Buch einer Rabbinerin für interessierte Leserinnen und Leser. Es ist ein philosophisch-theologisches Buch, das einen hohen Anspruch hat, weil es prinzipielle Probleme der Theologie in unserer Gegenwart behandelt. Zu diesem Anspruch gehört, dass es Jüdinnen und Juden auf »Augenhöhe« mit Gott zeigt, in gleichwertiger Verantwortung füreinander und für die Welt.
Klapheck argumentiert deshalb mit dem für unsere Zeit selbstverständlich gewordenen Vokabular der Politik, mit Begriffen wie »Autonomie«, »Reziprozität«, »gleichwertig«, »Emanzipation« und »Freiheit«. Sie gehören zu dem umfassenderen Begriff des Rechtsstaates. Diese Begriffe werden aber nicht allein in ihrer aktuellen Bedeutung verstanden, sondern sie dienen zugleich zur Beschreibung der grundlegenden Vorstellungen der jüdischen Tradition, die in der Bibel dargestellt werden und in den klassischen Werken der Rabbinen ihre Fortsetzung finden. Exemplarisch lässt sich das am ersten und umfangreichsten Kapitel »Gott und die Polis« darstellen.
Darin entwickelt Klapheck ihre Überzeugung, dass sich die Hebräische Bibel »nicht auf einen despotischen Schöpfergott« festlegt. Vielmehr wird dieser durch seine »sich zum Menschen entwickelnde Beziehung« immer wieder dazu animiert, sich selbst neu zu gestalten, seine Beziehung zum Menschen »auszuhandeln«. Gott wird auf diese Weise zum »politischen Partner des Menschen«. Eine solche Partnerschaft ist eine »produktive Konflikt-Beziehung«, in der die »Selbstermächtigung des Menschen« zeigt, dass er Gott gegenüber gleichwertig ist.
SÜNDENFALL Die Urszene für diese Selbstermächtigung sieht Klapheck im biblischen Sündenfall, den sie als Ausbruch der »latenten Opposition« des Menschen gegenüber Gott deutet. Durch Evas »Fehltritt« trotzt der Mensch Gott seine Autonomie ab. In Abrahams Streit mit Gott um die Zerstörung Sodoms setzt sich dieser Prozess der Emanzipation fort.
Diese Konflikte sind für den Menschen segensreich, da die gewonnene Autonomie ihm die Fähigkeit verleiht, selbst aktiv »Welten zu schaffen«. In diese neuen Welten aber »soll« Gott eingebunden werden. Denn die Autonomie des Menschen aktiviert zugleich Gottes »politischen Anteil« an dem Weltgeschehen.
Die jüdische Tradition hat für Klapheck eine immanente politische Dimension, die ihren Ausdruck im Ringen zwischen den hierarchischen und egalitären Kräften im Judentum findet. Indem sie die Tora politisch liest, erscheinen ihr viele Themen in einem neuen Licht. Das jüdische Leben in der Diaspora sieht sie als gleichwertig mit dem Leben in Israel. In beiden verwirklicht sich ein Modus jüdischer Existenz.
ausrichtung Klaphecks politische Theologie des Judentums besitzt eine optimistische Ausrichtung. Mit ihr vermag sie Leserinnen und Leser, die von der jüdischen Tradition her ganz anders konditioniert sind, für sich zu gewinnen. Ihr politisch-theologisches Vokabular ist das unserer Zeit. Es ist Ausdruck des Willens zur politischen Freiheit.
Sie setzt damit ein Zeichen gegen Konfrontation oder Unterdrückung. Regierende Despoten und solche, die darauf warten, ihre Mitmenschen zu unterwerfen, hat unsere Zeit genug. Insofern ist Elisa Klaphecks politische Theologie der Bibel eine Lektüre, die zu befreien vermag.
Elisa Klapheck: »Zur politischen Theologie des Judentums«. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2022, 242 S., 24 €