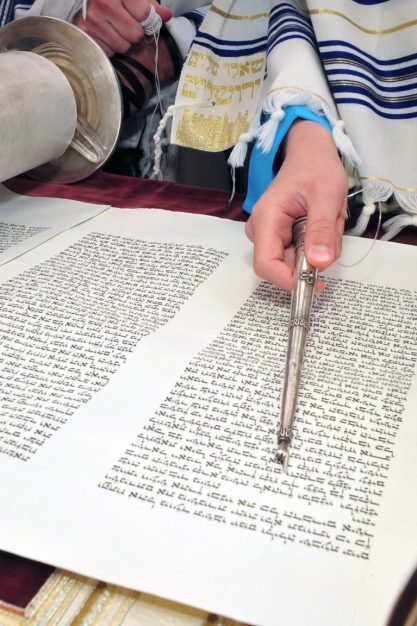Im Traktat Brachot 6 diskutiert der Talmud die Bedeutung des Betens in einer Synagoge und mit einem Minjan. Wir gehen dreimal täglich in die Synagoge, um zu beten. Und doch wissen wir, dass Haschems Ruhm die ganze Welt erfüllt. Warum müssen wir uns dann die Mühe machen und zum Gebet hinausgehen, wenn wir doch auch gemütlich zu Hause beten könnten?
Es wird gelehrt, dass Abba Binjamin sagte: »Das Gebet eines Menschen wird nur in einer Synagoge erhört, wie es heißt: ›Dem Lied und dem Gebet zuzuhören‹.« Also genau dort, wo wir dem Ewigen Lob- und Ruhmeslieder singen, sollte auch das Gebet (das Schemone Esre, also die Amida) rezitiert werden.
MINJAN Aber warum versuchen wir, gerade mit einem Minjan von zehn Männern zu beten? Ravin bar Rabbi Ada sagte: »Woher wissen wir, dass die Schechina, die Präsenz G’ttes, überall zu finden ist, wo zehn Männer beten? Weil es heißt: ›Der Ewige steht in der Gemeinde G’ttes.‹« Mindestens zehn Männer gelten als Gemeinde, und sie sind würdig, die Schechina in ihrer Mitte zu haben.
Dass eine Gemeinschaft mindestens aus zehn volljährigen Männern besteht, lernen wir aus dem Wochenabschnitt Schelach Lecha, in dem davon erzählt wird, wie das jüdische Volk zwölf Spione ins Land Israel schickte, um es zu erkunden. Zehn der zwölf äußerten sich schlecht über das Land und wurden von der Tora als »böse Gemeinschaft« bezeichnet. Dem entnehmen wir, dass mindestens zehn Männer eine Gemeinschaft (Minjan) bilden.
SCHECHINA Doch Haschems Geist weilt auch unter weniger als zehn Personen. Wenn drei Richter zu Gericht sitzen, gesellt sich der Ewige zu ihnen. Wir lernen dies aus dem Vers: »Inmitten der Richter richtet Er.« Das hier verwendete Wort »Elohim« kann sich entweder auf Haschem oder auf Richter beziehen, wie wir im 2. Buch Mose 22,7 sehen: »Und der Besitzer soll zu den Richtern (Elohim) gebracht werden.« Auch wenn zwei Männer gemeinsam Tora lernen, schließt sich die Schechina ihnen an, wie es heißt: »Da redeten die Frommen miteinander, und Haschem hörte zu, und Er hörte. Und ein Buch der Erinnerung wird vor Ihm geschrieben für die Frommen und die, die Seinen Namen ehren.«
Sogar jemand, der allein sitzt und Tora lernt, wird mit der g’ttlichen Gegenwart belohnt, denn es heißt: »Wo immer Mein Name erwähnt wird, dort werde Ich dir erscheinen und dich segnen.«
Doch das Maß an g’ttlicher Gegenwart, das eine einzelne Person genießt, kann nicht mit dem, das zwei Menschen genießen, verglichen werden. Und die g’ttliche Gegenwart, die von zwei Menschen erfahren wird, ist nicht dieselbe wie die von drei. Ebenso ist der Grad der Schechina, der auf drei Menschen ruht, nicht derselbe wie der, der auf zehn Männern ruht.
STUDIUM Eine Person, die allein Tora lernt, genießt die Gegenwart des Ewigen, aber ihr Studium ist nicht so bedeutsam wie das von zweien, die miteinander Tora lernen. Wenn zwei Menschen gemeinsam lernen, können sie das Thema viel besser verstehen und zum wahren Sinn gelangen. Aber wenn jemand, der allein studiert, irrt oder missversteht, gibt es niemanden, der ihn korrigieren könnte. Aus diesem Grund sind zwei, die gemeinsam Tora studieren, im Gedenkbuch der G’ttesfurcht verzeichnet.
Auch drei Richter, die zu Gericht sitzen, werden durch die g’ttliche Gegenwart belohnt, denn obwohl sie nicht wirklich mit dem Studium beschäftigt sind, nutzen sie doch ihr Studium für ihr Urteil.
Wenn sich zehn Männer in einer Synagoge zum Gebet versammeln, geht ihnen tatsächlich die Schechina voraus, die bereits da ist, um sie zu begrüßen. Dies geschieht jedoch nur bei einer Gruppe von zehn oder mehr Personen. Jede Person, die immer im Minjan in einer Synagoge betet und eines Tages den Minjan verpasst, fragt Haschem selbst: »Warum ist der und der nicht gekommen?«