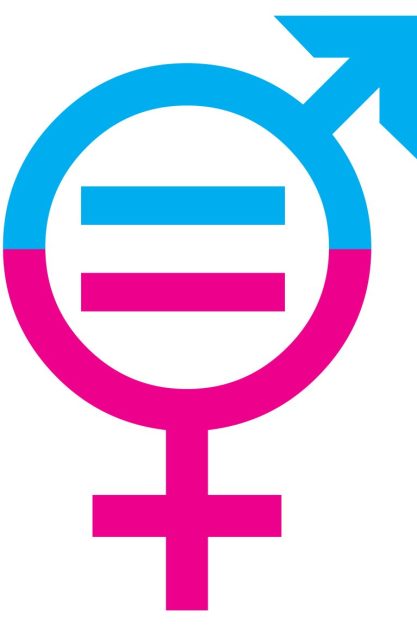Der Text der Doppel-Parascha beginnt in Matot, wie er in Mass’ej endet. Es geht um das Thema Frauenrechte, genauer gesagt um eine ungleiche rechtliche Stellung von Mann und Frau.
Zu Anfang heißt es, dass alles, was ein Mann gelobte, von ihm erfüllt werden müsse. Dabei darf er sein Gelübde nicht nur in Gedanken formulieren, sondern muss es tatsächlich ausgesprochen haben. Das gesprochene Wort erhält damit eine Art Vertragscharakter.
gelübde Wenn aber eine Frau auf gleiche Weise etwas gelobte, konnte tatsächlich ihr Vater oder ihr Ehemann das Gelübde für ungültig erklären. Wie kann das sein? Ist denn das Wort einer Frau weniger wert als das eines Mannes? Will diese Vorschrift ihr etwa mangelnde Ernsthaftigkeit unterstellen?
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass dem keinesfalls so ist. Zum einen wird ausdrücklich festgehalten, dass das Wort einer Witwe und einer geschiedenen Frau uneingeschränkt gültig ist. Kein Mann kann ihr Gelöbnis willkürlich aufheben.
Zum anderen können Gelübde sowohl einer Ehefrau als auch einer Unverheirateten, die noch beim Vater wohnt, nicht ohne Weiteres annulliert werden. Der Vater oder Ehemann muss noch am selben Tag sein Veto einlegen, wenn er eine Ungültigkeit erreichen will. Schweigt er aber dazu mindestens bis zum Tag darauf, dann ist alles, was gelobt wurde, gültig.
frist Falls der Vater oder der Ehemann erst nach dieser Frist kundtut, dass er der Tochter oder der Frau das Halten eines Gelübdes verwehrt, dann wertet dies der Ewige als Unrecht: »Will er sie [die Gelübde] nach der Zeit seines Vernehmens dennoch aufheben, so soll er die Schuld seiner Frau tragen.« Man bedenke dabei, dass die Gelübde ja dem Ewigen gegenüber gegeben wurden, der Mann aber nun nach seinem eigenen menschlichen Willen deren Erfüllung verhindert. Der Frau wird der Ewige verzeihen, wenn sie dadurch gezwungenermaßen ihr Wort nicht halten kann, nicht aber dem Mann.
Wir finden hier eine Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts von Frauen im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit von Gelübden, ja, des gesprochenen Wortes überhaupt, die an sich für Männer und Frauen gleichermaßen gilt.
Um den Wortlaut eines anderen Rechts und dessen menschlicher Auslegung geht es schließlich in Mass’ej, und zwar um das Erbrecht von Frauen, deren Väter keine Söhne haben, die erben könnten. Bereits in der Parascha Pinchas vertreten die fünf Töchter des Zlofchad ihren Anspruch vor Mosche, den Ältesten und der ganzen Gemeinschaft, und der Ewige – vermutlich zum großen Erstaunen nicht nur von Mosche – gibt ihnen recht. Und jetzt, gegen Ende des Buches Bamidbar, treten die Oberhäupter des Stammes, zu dem der verstorbene Zlofchad gehörte, heran und verlangen eine Einschränkung genau dieses Erbrechts.
joweljahr Was, wenn eine solche erbberechtigte Tochter in einen anderen Stamm einheiratet? Dann ginge das Land dauerhaft in den Besitz dieses Stammes über, und nicht einmal das Joweljahr könnte das neue Besitzrecht auflösen, gilt es doch nur für verkauftes, nicht aber für geerbtes oder durch Heirat erworbenes Land.
Die Männer verlangen, dass eine Frau in einem solchen Fall jemanden aus ihrem eigenen Stamm heiraten müsse. Und diesmal, so scheint es, ist es Mosche selbst, der ihnen recht gibt. Wohl lesen wir an dieser Stelle, dass Mosche dies auf Befehl des Ewigen tut.
Und doch unterscheidet sich der Wortlaut hier von der ursprünglichen Entscheidung im Abschnitt Pinchas. Dort steht ausdrücklich, dass Mosche den Rechtsfall vor den Ewigen bringt, und der Ewige bestätigt das Erbrecht der Frauen, und zwar ohne Einschränkung der Partnerwahl. In Mass’ej aber sagt Mosche, der Ewige habe den Töchtern des Zlofchad geboten, sie könnten sich vermählen mit einem Mann, »der gut ist in ihren Augen«, aber der müsse natürlich schon aus demselben Stamm wie ihr Vater kommen.
Und »so wie der Ewige Mosche geboten, so taten die Töchter Zlofchads, und es wurden Machla, Tirza, Chogla, Milka und Noa, die Töchter Zlofchads, den Söhnen ihrer Onkel zu Frauen, (…) und ihr Erbteil blieb bei dem Stamm des Geschlechtes ihres Vaters«.
verpflichtung Geschah dies nun freiwillig, oder agierten die fünf Frauen aus Verpflichtung gegenüber einem Gebot des Ewigen? Und war es denn tatsächlich ein Gebot des Ewigen – oder handelte es sich lediglich um eine von Menschen gemachte Einschränkung? Hätten sie sich theoretisch auch mit Männern aus einem anderen Stamm verheiraten können? Und wenn ja, hätte dieses Recht nur für sie allein gegolten oder auch ganz allgemein für alle erbberechtigten Frauen?
Über die Diskrepanz im Wortlaut beider Textstellen diskutieren unsere Weisen im Talmud (Bawa Batra), und das mit durchaus unterschiedlichen Ansichten. So sagte Rabbi Jehuda im Namen von Schmuel, die Töchter des Zlofchad hätten Männer aus jedem beliebigen Stamm heiraten können. Aber sie taten es nicht.
Denn sie hätten sich durchaus an den Rat des Schriftverses gehalten, »wer gut ist in ihren Augen, dessen Frauen mögen sie werden« – und das waren eben Männer aus der eigenen Familie, da nur diese ihrer auch würdig waren. Damit wäre dies aber kein Gebot gewesen, sondern eine Empfehlung.
Erbe Die Baraita widerspricht dem und besagt, es sei allgemeines Recht gewesen, dass erbberechtigte Frauen innerhalb ihres Stammes heiraten müssten. Rabba löst den Widerspruch auf mit der Darlegung, es sei nach der Halacha ein gültiges Recht für alle, mit der Ausnahme von Zlofchads Töchtern. Diese seien tatsächlich als Einzige berechtigt gewesen, sich frei zu entscheiden. Und doch haben sie sich ihre Partner aus der eigenen erweiterten Familie ausgesucht – obwohl anzunehmen ist, dass sie durchaus Männer aus anderen Stämmen hätten kennenlernen können.
Der Hinweis auf Tu beAw als den Tag, an dem den Stämmen gestattet wurde, sich miteinander zu verbinden, findet sich im Traktat Bawa Batra interessanterweise gleich nach der Diskussion sowohl über die Töchter des Zlofchad als auch über die Auflösung von Gelübden von Frauen. Das Beispiel von Zlofchads Töchtern lehrt uns, nicht passiv den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern Rechte einzufordern und wahrzunehmen.
Die Autorin ist Rabbinerin der Liberalen Jüdischen Gemeinde Mischkan ha-Tfila Bamberg und Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK).
inhalt
Der Wochenabschnitt Matot erzählt von Mosches letztem militärischen Unternehmen, dem Feldzug gegen die Midianiter. Danach teilen die Israeliten die Beute auf und besiedeln das Land.
4. Buch Mose 30,2 – 32,42
»Reisen« ist die deutsche Übersetzung des Wochenabschnitts Mass’ej. Und so beginnt er auch mit einer Liste aller Stationen der Reise durch die Wildnis von Ägypten bis zum Jordan. Mosche sagt den Israeliten, sie müssten die Bewohner des Landes vertreiben und ihre Götzenbilder zerstören.
4. Buch Mose 33,1 – 36,13