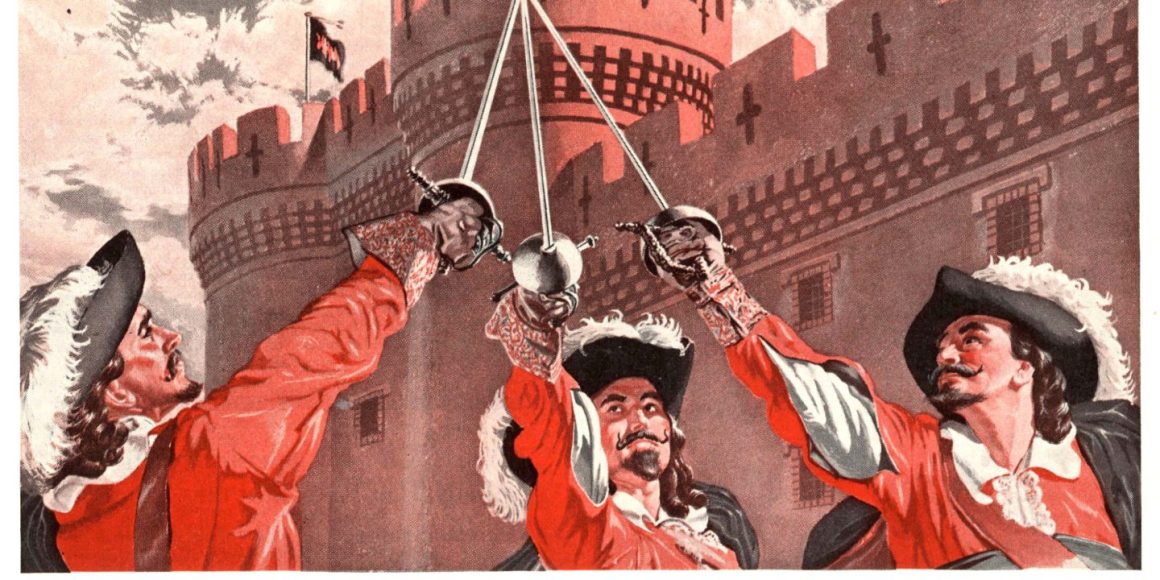Paraschat Nizawim beginnt mit dem Bund, den Gʼtt mit seinem Volk schließt. Es heißt (5. Buch Mose 29, 9–14): »Ihr steht heute alle vor dem Ewigen, eurem Gʼtt: eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Beamten, jeder Mann Israels, eure Kinder, eure Frauen und der Fremde in deinem Lager (…), um in den Bund des Ewigen, deines Gʼttes, einzutreten und in Seinen Eid, den der Ewige, dein Gʼtt, heute mit dir schließt, damit Er dich heute zu Seinem Volk mache und Er dein Gʼtt sei, wie Er dir gesagt hat und wie Er deinen Vätern, Awraham, Jizchak und Jakow geschworen hat.« Weiter heißt es: »Nicht nur mit euch allein schließe ich diesen Bund und diesen Eid, sondern auch (…) mit denen, die heute nicht mit uns hier sind.«
Raschi (1040–1105) erklärt den Ausdruck »und mit denen, die heute nicht mit uns hier sind« als »auch mit den zukünftigen Generationen«. Der Maharal, Rabbi Löw von Prag (1522–1609), fragt, wie man einen Bund schließen könne mit jemandem, der noch nicht existiert.
Rabbi Isaak Arama (1420–1494) vertieft dieses Problem angesichts des Grundsatzes, dass niemand seinen Kindern und Nachkommen eine ewige Verpflichtung aus einem Schwur oder Gelübde hinterlassen könne, solange sie diese nicht im Erwachsenenalter durch Zustimmung oder Schweigen akzeptieren.
Keine ewige Verpflichtung ohne Zustimmung - oder Schweigen
Der Text in der Tora fährt fort: »Es könnte unter euch jemanden geben (…), dessen Herz sich heute von dem Ewigen, unserem Gʼtt, abwendet, um den Göttern jener Völker zu dienen, und es könnte unter euch eine Wurzel geben, die Gift und Wermut hervorbringt. Und wenn jemand die Worte dieses Eides hört und sich in seinem Herzen segnet und sagt: ›Friede wird mir sein, auch wenn ich in der Sturheit meines Herzens wandere‹ (…), dann wird der Ewige nicht vergeben, sondern der Zorn des Ewigen und seine Eifersucht werden gegen diesen Mann entbrennen (…), und der Ewige wird seinen Namen unter dem Himmel auslöschen. Der Ewige wird ihn von allen Stämmen Israels (…) trennen« (5. Buch Mose 29, 17–20).
Diese Verse erfordern eine Erklärung. Erstens: Was dachte sich der Mensch, den Bund zu brechen? Zweitens: Warum segnete er sich selbst, dass ihm nichts Schlechtes geschehen werde? Drittens: Warum muss man ihn von ganz Israel trennen, um ihn zu bestrafen?
Der Bund wird nicht mit dem Einzelnen, sondern mit dem gesamten Volk Israel geschlossen: Der Maharal erklärt, dass der Bund, den der Allmächtige mit Israel geschlossen hat, kein Bund mit Einzelnen ist, sondern ein Bund mit der Nation als Ganzes. Dieser Bund ist ewig und gilt auch für zukünftige Generationen, da er nicht mit einem Menschen aus Fleisch und Blut geschlossen wird, sondern mit dem, was »die Seele der Nation Israels« genannt wird, und daher ist auch jeder automatisch bei seiner Geburt verpflichtet, die Tora einzuhalten.
Die Seele eines Israeliten ist in ihrem Ursprung mit der Seele der ewigen Nation Israel verbunden
Da jede Seele eines Israeliten in ihrem Ursprung mit der Seele der ewigen Nation Israel verbunden ist, ist es verständlich, dass, so wie die Nation ewig ist, sich auch die Heiligkeit Israels ewig auf jede Generation und auf jedes einzelne Mitglied Israels überträgt, ungeachtet seiner Taten.
Der Prophet Jehoschua (7,11) schreibt: »Israel hat gesündigt« – es heißt nicht »das Volk hat gesündigt«, sondern »Israel«, um uns zu lehren, auch wenn sie sündigen, bleiben sie Israel. Ein Jude hört nicht auf, an den Bund mit Gʼtt gebunden zu sein, selbst wenn er die Wege des Ewigen verlässt.
Wäre der Bund eine individuelle Angelegenheit zwischen dem einzelnen Menschen und Gʼtt, gäbe es keinen Grund für die gegenseitige Verantwortung ganz Israels füreinander, da jeder nach seinem Glauben leben würde und seinen privaten Bund brechen könnte, ohne dass dies die Gültigkeit des Bundes seines Nächsten beeinträchtigt. Doch gemäß der Erklärung des Maharal, wonach dieser Bund zwischen dem Allmächtigen und der gesamten Nation besteht und nicht mit jedem Einzelnen, kann man den Grundsatz »Ganz Israel haftet füreinander« verstehen.
»Ganz Israel haftet füreinander«
So finden wir im Midrasch Wajikra Rabba (4,6) die Worte von Rabbi Schimon Bar Jochai: »Ein Gleichnis für Menschen, die auf einem Schiff saßen. Einer von ihnen nahm einen Bohrer und begann, unter sich in seiner Kabine zu bohren. Seine Gefährten sagten zu ihm: ›Was tust du?‹ Er sagte zu ihnen: ›Was kümmert es euch, ich bohre doch nur unter mir.‹ Da sagten sie zu ihm: ›Das Wasser steigt und überflutet das ganze Schiff.‹«
Weil der Sünder der Meinung war, der Bund sei nur mit der gesamten Nation geschlossen, womit der Verstoß des Einzelnen keine Auswirkung auf das ganze Volk habe, und er ferner durch die vielen Gerechtigkeiten der Gerechten weiterlebe, sei ihm der Friede gesichert. Deshalb schreibt die Tora, dass der Ewige ihm nicht vergeben wird. Im Gegenteil, weil der Bund mit dem gesamten Volk geschlossen wurde und jeder als untrennbarer Teil der Nation angesehen wird, gilt die Sünde des Einzelnen als Vertragsbruch.
Daher heißt es, dass Gʼtt diese Person vom Ganzen absondern und individuell bestrafen wird, als wäre sie nicht ein Teil des Ganzen, entsprechend dem wichtigen Prinzip »Mida keneged mida«, Maß für Maß. Er war der Meinung, dass ein Einzelner keinen Einfluss auf das Ganze hat, deshalb wird er auch als ein Einzelner bestraft, und die Taten der Gerechten werden ihm nicht helfen.
Von den Wasserträgern bis zu den Stammesführern: Jeder ist verantwortlich
Der Bund betraf jeden Bereich der Gesellschaft im Volk Israel, von den Wasserträgern bis zu den Stammesführern, denn jeder ist verantwortlich, innerhalb seines sozialen Rahmens zu handeln. So wie die Weisen sagten: »Jeder, der die Macht hat, Protest in der ganzen Welt zu erheben und es nicht tut, wird für die ganze Welt verantwortlich gemacht; jeder, der die Macht hat, in seiner Stadt zu protestieren und es nicht tut, wird für seine Stadt verantwortlich gemacht; und jeder, der die Macht hat, in seinem Haus zu protestieren und es nicht tut, wird für sein Haus verantwortlich gemacht.«
In jedem Juden ist ein g’ttlicher Funke, der von der ewigen »Seele der Nation Israels« stammt. Dieser Funke bleibt in seiner Seele für immer eingeprägt, ungeachtet seiner äußeren Taten. Deshalb gilt der Bund für jede Person Israels in allen Generationen.
Der Autor studiert am Rabbinerseminar zu Berlin.
INHALT
Im Zentrum des Wochenabschnitts steht der Bund des Ewigen mit dem gesamten jüdischen Volk. Diesmal sind ausdrücklich auch diejenigen Israeliten miteinbezogen, die nicht anwesend sind: die künftigen Generationen. G’tt versichert den Israeliten, dass Er sie nicht vergessen wird, doch sie sollen die Mizwot halten.
5. Buch Mose 29,9 – 30,20
Im Wochenabschnitt Wajelech geht es um Mosches letzte Tage. Er erreicht sein 120. Lebensjahr und bereitet die Israeliten auf seinen baldigen Tod vor. Er verkündet, dass Jehoschua sein Nachfolger sein wird. Die Parascha erwähnt eine weitere Mizwa: In jedem siebten Jahr sollen sich alle Männer, Frauen und Kinder im Tempel in Jerusalem versammeln, um aus dem Mund des Königs Passagen aus der Tora zu hören. Mosche unterrichtet die Ältesten und die Priester von der Wichtigkeit der Toralesung und warnt sie erneut vor Götzendienst.
5. Buch Mose 31, 1–30