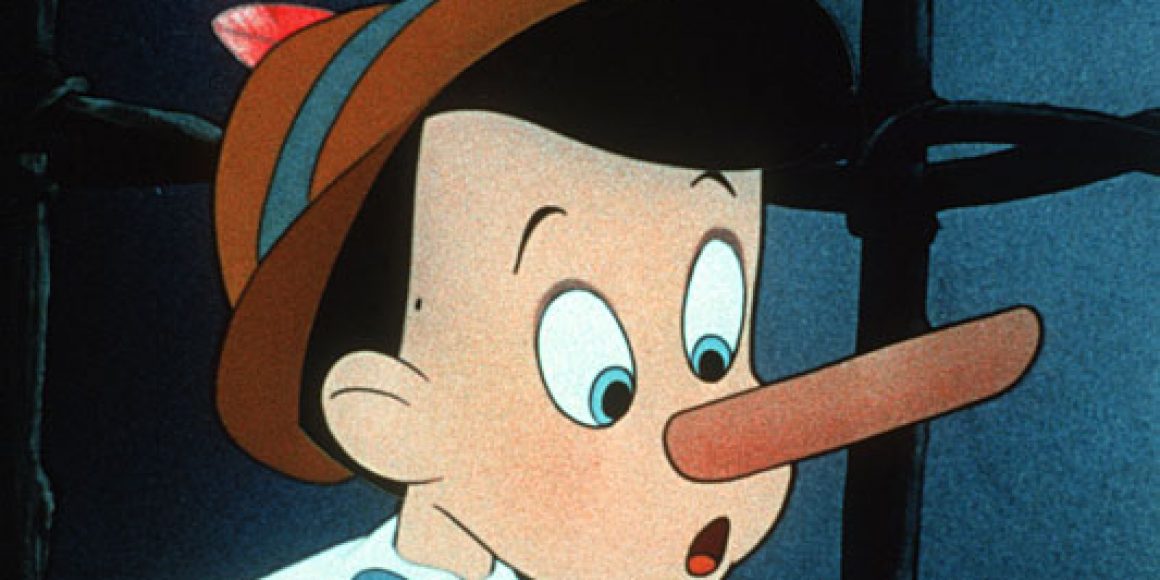Gleich drei Hauptaspekte des Judentums werden in der Parascha dieses Schabbats beleuchtet: die Willensfreiheit, die Auserwählung und die damit verbundene Verantwortung gegenüber uns selbst, unseren Mitmenschen und unserem Schöpfer.
Unter den vier unmittelbar nach der Überschreitung des Jordans vorgesehenen Zeremonien war diejenige der Bestätigung des Bundes auf den Bergen Ewal und Garisim sicherlich die beeindruckendste. Die feierliche Handlung fand in der Nähe von Schechem statt, wo schon Awraham und Jaakow gerastet hatten.
bundeslade Der Ort der Handlung liegt in einer Talsenke, umgeben von zwei Bergen. Während der Garisim in den Midraschim als grün bekannt ist, zeigt sich der Ewal kahl und schroff – er ist damit eine ideale Kulisse für die eindrucksvolle und lehrreiche Zeremonie: Sechs Stämme (Schimon, Levi, Jehuda, Jisachar, Josef und Benjamin) erklimmen den Berg Garisim, die sechs anderen Stämme (Re’uven, Gad, Ascher, Sewulun, Dan und Naftali) den Berg Ewal.
In der zwischen beiden Bergen liegenden Talsenke steht der Aron Habrit, die Bundeslade, mit den steinernen Gebotstafeln, umgeben von den Kohanim und Leviim. Gemäß der talmudischen Interpretation sprechen sie immer im Wechsel einen Segensspruch und einen Fluch, wobei der Segensspruch der negativen Form des Fluches entsprach.
Sie wenden sich also dem Berg Garisim zu und riefen: »Gelobt sei derjenige, der keine gehauenen oder gegossenen Götzen herstellt.« Das ganze Volk antwortet mit »Amen!«. Dann wenden sie sich zum Berg Ewal und sprechen: »Verflucht sei derjenige, der gehauene oder gegossene Götzen macht.« Erneut antworten die Stämme: »Amen!«
Willensfreiheit Das Geschehen führt uns die schlimmsten menschlichen Verfehlungen religiöser und moralischer Art in Kurzform vor Augen. Diese zwölf Fälle verdeutlichen uns die Konsequenzen falsch verstandener Willensfreiheit, nicht wahrgenommener Verantwortung und Missachtung des Gedankens der Auserwählung: Götzendienst, Missachtung der Eltern, Verrücken von Grenzsteinen, Mangel an Empathie gegenüber Blinden und Hilflosen, Gerechtigkeit, Unzucht, Mord, Bestechung, allgemeine Respektlosigkeit und Ungehorsam gegenüber der Tora.
Warum gibt es diese Deklaration? Unsere Gelehrten weisen darauf hin, dass die eben genannten Verfehlungen im Verborgenen begangen werden und daher nicht immer von der irdischen Justiz bestraft werden können. Rabbiner David Zvi Hoffmann (1843–1921) erklärt, dass die genannten Vergehen in Ägypten und Kenaan begangen wurden und die herrschende Bevölkerungsschicht leicht zu diesen Untaten bereit war, weil sie keine juristischen Konsequenzen zu befürchten hatte.
Für uns im Hier und Heute lebende Juden bildet diese Deklaration einen Wegweiser ethischen Verhaltens im Alltags- und Familienleben. Sie zeigt uns die verheerenden Auswirkungen menschlichen Fehlverhaltens. Sie warnt uns vor Selbstbetrug und Vorspiegelung falscher Tatsachen und ermahnt uns, ehrlich zu uns selbst und gegenüber unseren Mitmenschen zu sein.
mitmenschen Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) kommentiert, dass derjenige, der nach außen den G’ttesfürchtigen spielt, aber im Geheimen G’ttes Existenz leugnet, sich selbst sehr schadet. Gleiches gilt für denjenigen, der nach außen seine Eltern respektiert, sie in seinem Inneren aber verachtet; der vor Menschen rechtschaffen dastehen möchte, aber innerlich stets auf seinen eigenen Vorteil achtet; der vor Klugen und Einsichtigen für das Wohlergehen des Mitmenschen schwärmt, andere, nicht wissende Menschen aber ins Unglück stürzt; der vor Mächtigen und Großen kriecht, Schwachen und Hilflosen aber jede Unterstützung versagt; der Anstand vorgibt, in vertrauter Heimlichkeit jedoch ausschweift.
Deutlicher als in unserer Parascha kann die Warnung vor Heuchelei und Falschheit nicht formuliert werden. Es ist ein guter Brauch, an jedem Schabbat ein Kapitel Tehillim zu sagen, das inhaltliche Bezugspunkte zum Thema der jeweiligen Parascha aufweist. Für diesen Schabbat ist es Psalm 51, in dem David von seinem Fehltritt berichtet, den Folgen und der großen Chance, die G’tt ihm nach seiner Reue über die begangene Verfehlung eröffnet.
Verfehlungen Im 4. und 5. Vers des genannten Psalms finden wir eine gewichtige Parallele zu unserem Wochenabschnitt. David bittet G’tt um Reinigung von seinen Verfehlungen, weil sie ihm bewusst und stets gegenwärtig sind. Rabbiner Hirsch erklärt, dass jede Verfehlung in zwei Richtungen wirkt: gegen das eigene Innere und gegen die Mitmenschen. Sowohl das innere Gleichgewicht als auch die Beziehung zur Außenwelt werden gestört.
Indem die Tora, unsere Lehre des Lebens, die im Sinnlichen und im Geistigen begründete Doppelnatur des Menschen in einer sehr realistischen Perspektive akzeptiert, eröffnet sie dem Menschen immer wieder aufs Neue die Chance, wieder zur Erkenntnis des Wahren und zur Liebe des Reinen und Guten geführt zu werden. Ziel der Tora ist es, uns Menschen fortwährend bewusst zu machen, dass wir uns in einem Prozess ständiger Erneuerung, Teschuwa, befinden, der ohne Willensfreiheit nicht möglich ist.
In wenigen Tagen werden wir wieder die Slichot sagen, deren Zentrum der Pijut »Schma Kolejnu« bildet, in den gleichfalls der 13. Vers aus Psalm 51 eingeflochten ist in Form der flehentlichen Bitte an G’tt, den Beter nicht aus Seinem Angesicht fortzuwerfen und den Geist der Heiligkeit nicht von ihm zu nehmen. Unser Wochenabschnitt und der ihm entsprechende Psalm bieten also eine hervorragende Gelegenheit, sich auf die Hohen Feiertage vorzubereiten.
Der Autor ist Leiter des religiösen Erziehungswesens der IKG München.
Inhalt
Im Wochenabschnitt Ki Tawo werden die Israeliten aufgefordert, ihre Dankbarkeit für die reiche Ernte und die Befreiung aus der Sklaverei auszudrücken. Sie sollen ein Zehntel der Erstlingsfrüchte opfern. Ihnen wird aufgetragen, die Gebote G’ttes auf großen Steinen auszustellen, sodass alle sie sehen können. Danach schildert die Tora Fluchandrohungen gegen bestimmte Vergehen der Leviten. Den Flüchen folgt die Aussicht auf Segen, wenn die Mizwot befolgt werden. Zum Abschluss der Parascha erinnert Mosche die Israeliten an die vielen Wunder in der Wildnis und daran, dass sie den Bund mit dem Ewigen beachten sollen.
5. Buch Mose 26,1 – 29,8