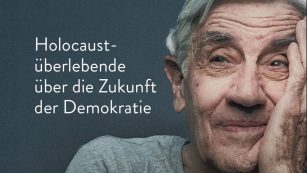Sie essen keine Schalentiere, und Fleisch muss von Tieren stammen, die Wiederkäuer sind und gespaltene Hufe haben. Kein Krabbencocktail also. Dagegen ist ein Rindersteak für Juden erlaubt, solange es schön durchgebraten ist. Tierblut soll ein gläubiger Jude nicht konsumieren, weil es als Sitz der Seele gilt.
Für die koschere Küche gibt es zahlreiche Vorschriften – sofern sie befolgt werden. Aber warum ist das so? Was hat Essen mit Gott zu tun? »Koscher to go« heißt eine neue Vortragsreihe des Jüdischen Museums Berlin, die sich mit Essensgeboten unterschiedlicher Religionen befasst. Zu jeder Sitzung – geplant sind mehrere Teile bis Ende des Jahres – sind ein Judaist sowie ein Wissenschaftler einer anderen Disziplin eingeladen. Zum Auftakt ging es am Donnerstagabend um »Göttliches essen und trinken – wozu Speisegebote?« in einer Online-Diskussion.
geschichte »Das Besorgen von Nahrung war im Laufe der Geschichte oft eine Herausforderung für die Menschheit«, erklärt David Kraemer, Professor für Talmud und Rabbinische Studien am Jewish Theological Seminary of America. Daher gebe es keine Kultur, die nicht versucht habe, mittels bestimmter Vorschriften die Nahrungsaufnahme zu beschränken – es war eben nicht immer alles im Überfluss vorhanden. Entsprechend wird Essen im Judentum – wie in vielen anderen Religionen auch – als Gottesgabe gesehen.
Fleisch war bereits in der Antike etwas Besonderes, das teuer war und entsprechend selten nur zu Feiertagen gegessen wurde.
So war Fleisch bereits in der Antike etwas Besonderes, das teuer war und entsprechend selten nur zu Feiertagen gegessen wurde. Die Menschen ernährten sich hauptsächlich von Hülsenfrüchten. In der Tora – den fünf Büchern Mose – finden sich Listen von Tieren, die gegessen werden dürfen. »Das sind dann etwa Tiere, die keine anderen Tiere fressen, Weidetiere also«, sagt Kraemer. Dahinter steckte die Einstellung: »Wir sind das, was wir essen«.
Erst später dann dienten die jüdischen Speisegesetze dazu, »die jüdische Identität zu schützen«, so Kraemer. Dies habe sich nach dem babylonischen Exil so entwickelt, als die Juden nach Israel zurückkehrten und dort mit einer gemischten Bevölkerung – Persern, Griechen, Römern – zusammenlebten. »Die Juden sollten nicht mit ihren Nachbarn essen, keine Beziehung zu ihnen entwickeln. Damit wollte man die Identität einer Minderheit schützen, die in einer Mehrheitsgesellschaft mit anders gläubigen Menschen lebte«, erklärt der Wissenschaftler.
essensvorschrift Aus diesem Grund sei auch die strikte Trennung von Milch und Fleisch vorgeschrieben worden, mit Bezug auf das zweite Buch Mose: »Koche nicht ein Böcklein in der Milch seiner Mutter« (Exodus, 23,19). Keine einzigartige Essensvorschrift übrigens – diese Trennung von Milch und Fleisch »kennen auch andere Kulturen, zum Beispiel die Massai im Süden Kenias«, sagt Kraemer.
Je mehr Assimilation im Laufe der Jahrhunderte stattfand, je größer die Nähe von Juden und Nichtjuden wurde, desto strikter wurden die Speisegesetze, die die Rabbiner erließen. »Mittlerweile sind sie viel strenger als jemals in der Vergangenheit – ein orthodoxer Rabbiner könnte bei einem Rabbiner des Mittelalters nicht essen«, so Kraemer.
Und die heutige Massentierhaltung? Ist die mit koscheren Gesetzen vereinbar? Kraemer betont, dass Massentierhaltung und die Grausamkeit, die damit einhergeht, in der vormodernen Welt kein Thema waren. »Tiere wurden nicht auf diese Weise behandelt und hatten nicht so zu leiden, wie das heute der Fall ist.«
säkularisierung Im Buddhismus etwa ist der Genuss von Fleisch untersagt, wenn dafür ein Tier getötet werden muss, so Kikuko Kashiwagi-Wetzel, Professorin für deutsche Literatur und Kultur im japanischen Osaka. Eine alte Regel, die mit der Säkularisierung des Buddhismus aufweichte – und dennoch an mancher Stelle präsent ist: So wird in Japan etwa Fleisch immer klein geschnitten und ohne Knochen angeboten, damit die Herkunft – das Töten eines anderen Lebewesens – nicht allzu explizit wird.
Auch wichtig zu wissen für Japan-Reisende: »Es gilt als verpönt, Essen mit Stäbchen weiterzureichen«, erklärt Kashiwagi-Wetzel. So erinnere es an ein Bestattungsritual: »Nach einer Einäscherung legen Angehörige mit Stäbchen die Überreste der Knochen in eine Urne«.