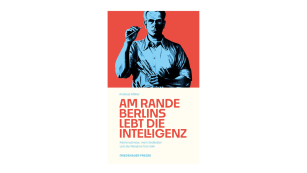Dieser Tage sucht sich der Geist mitunter seltsame Wege zur Selbstberuhigung. Meiner führte mich zu YouTube und einer BBC-Doku über das Schreiben im England des 17. Jahrhunderts. Was konnte da schon passieren – weder Israel noch Kufiyas in Sichtweite! Stattdessen der lustige und zugleich so schlaue Autor Adam Nicolson, der auch gern über Küstenvögel, Strandgräser oder die Renaissance schreibt. Ich lehne mich zurück und lasse es rieseln.
»Im 17. Jahrhundert lernten Menschen aller Schichten lesen und schreiben, und durch ihre Schriften können wir sie kennenlernen wie nie zuvor in der Geschichte«, verkündet Nicolson fröhlich. »Tagebücher und Autobiografien beginnen, die innersten Regungen des Selbst ganz gewöhnlicher Menschen zu offenbaren. Die erste Generation von Briten, die ihre Geschichte selbst schreiben konnten.« Entspannung setzt ein.
Ein leidenschaftlicher und offensichtlich auch geiziger Buchhalter
Auftritt John Oglander (1585–1655). Bilder der Isle of Wight, Boote und Sonne tanzen auf dem Wasser, und die efeubedeckten Landhäuser haben fast die gleiche Wirkung wie der sizilianische Wein, den der beste aller Ehemänner mitgebracht hat. Oglander, Mitglied des Landadels und dem König treu ergeben, war leidenschaftlicher Buchhalter. Akribisch schrieb er alles auf, was seinen Haushalt Geld kostete oder ihm einbrachte. Von Lebensmitteln bis zu Ländereien.
Doch schließlich begann er, an den Rändern und buchstäblich zwischen den Zeilen persönliche Gedanken niederzuschreiben. Seine Zweifel, seine Pläne, Neuzugänge in der Familie, mal trocken, mal emotional. Ich bin so aufgeregt wie Nicolson. Das sei wohl das erste Tagebuch auf der Insel gewesen, sagt er.
Was bleibt eigentlich von uns, wenn Apple mal wieder ein Update schickt, das alles löscht?
Ich bin glücklich gefangen in der heilen Welt einer Vergangenheit, die nicht mehr zu ändern ist und sich ganz sicher anfühlt, wenn man in ihr bleibt. Als Nicolson davon berichtet, wie der offensichtlich auch geizige Oglander eines Tages verzweifelt vermerkt, dass ihn eine Reise seines Sohnes George nach Frankreich alles in allem 747 Pfund, drei Schilling und fünf Pence kostet, muss ich lachen. Er hat sich allen Ernstes in den Finger gestochen, um mit seinem Blut zu schreiben: »Sir John Oglander mit seinem eigenen Blut, das um seine großen Ausgaben trauert.« Oh, ich mag den Humor des Mannes, der seit 370 Jahren tot ist. Cheers, John.
Dann wird es traurig. Als der Vater einen Monat später erfährt, dass sein Sohn in Frankreich gestorben ist, schreibt er: »Mit Tränen statt Tinte schreibe ich diese Zeilen. George, mein geliebter George, ist tot, und mit ihm auch meine irdischen Freuden.«
Jede Höhlenmalerei erzählt mehr als eine nicht mehr lesbare Floppy Disk
Armer John, denke ich und schaue auf mein Handy. Was bleibt eigentlich von uns, wenn Apple mal wieder ein Update schickt, das alles löscht? In 100 Jahren werden die Menschen mehr über Oglander wissen als über die digitalen Sklaven des 21. Jahrhunderts. Jede Höhlenmalerei erzählt mehr als eine nicht mehr lesbare Floppy Disk, geschweige denn der Cloud-Salat, der uns vorgaukelt, dass unsere Gedanken und Bankverbindungen sicher sind. Genau genommen haben wir nichts! Nach einem weltumspannenden Stromausfall sitzen wir wieder in der Höhle.
Aber – und hier setzt der menschliche Optimismus ein, der auch ein bisschen nach Wein schmeckt – heißt es doch auch, dass wir neu anfangen können. Zuerst mit zarten Holzkohlestrichen »wieder erlernen«, was bereits in uns ist. Von abstrakt zu figurativ zu abstrakt. Rückversicherung der fundamentalen Werte und Normen. Mir wird schwindlig. Alle Möglichkeiten sind in uns, aber das Puzzle müssen wir selbst legen. Danke, John Oglander!