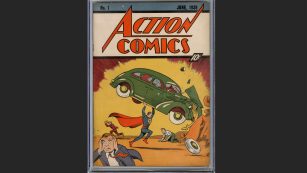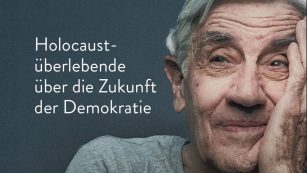An Thomas Mann kommt derzeit niemand vorbei, der sich für deutsche Literatur interessiert. Nicht nur, dass 2024 das wohl wichtigste Werk des Literaturnobelpreisträgers seinen 100. Geburtstag feierte: »Der Zauberberg«. Auch in den kommenden Wochen liefern zwei runde Gedenktage Anlass für neue Sachbücher und Romane, wissenschaftliche Symposien und Ausstellungen über den in Lübeck geborenen Schriftsteller.
Der nächste Höhepunkt des Festjahres ist der 6. Juni, Thomas Manns 150. Geburtstag. Die Thomas Mann-Gesellschaft hat dazu vom 5. bis 8. Juni eine Tagung in Lübeck organisiert. Am eigentlichen Geburtstag ist in der Hansestadt ein Festakt geplant, ab dem Folgetag wird im dortigen Sankt-Annen-Museum die Schau »Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie« zu sehen sein. Es gibt sogar ein Comicbuch und eine Playmobil-Figur des Dichters, das »Thomas Männchen«. Nach Luther, Goethe und Schiller folge der Autor in limitierter Sammlerauflage.
Runder Geburtstag und 70. Todestag
Dann folgt am 12. August der 70. Todestag des großen Erzählers, der 1955 in Zürich starb. Das hat zur Folge, dass seine Bücher in diesem Jahr gemeinfrei werden - also das Urheberrecht erlischt. Letzte exklusive Gelegenheit für seinen Verlag S. Fischer, neue Taschenbuchausgaben der Hauptwerke, Lesebücher und biografische Studien auf den Markt zu bringen.
Thomas Mann wuchs in Lübeck in einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie auf. Bereits in der Schule begann er zu schreiben. 1894 folgte er Mutter und Geschwistern nach München, wo er bei einer Versicherungsgesellschaft arbeitete, aber schon bald in den Journalismus wechselte. Hier verfasste Mann die Werke, die seinen Weltruhm begründeten: neben den »Buddenbrooks« und dem »Zauberberg« auch die Novelle »Der Tod in Venedig« und die ersten beiden Bände der Tetralogie »Joseph und seine Brüder«. 1905 heiratete er Katia Pringsheim; aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, darunter die Schriftsteller Erika, Klaus und Golo Mann.
Kehrtwende zur Weimarer Demokratie
1901 erschienen die »Buddenbrooks« und machten den Autor weltbekannt. Für den Roman, der vom sich über vier Generationen hinziehenden Niedergang einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie erzählt, erhielt er 1929 den Nobelpreis für Literatur.
Der Erste Weltkrieg faszinierte Mann, er sympathisierte - anders als sein Schriftsteller-Bruder Heinrich Mann - mit der Kriegspolitik des Kaiserreichs und dem Obrigkeitsstaat. In »Gedanken im Kriege« (1914) und »Betrachtungen eines Unpolitischen« (1918) ließ er sich ausführlich über die in seinen Augen positiven Aspekte des Krieges aus. 1922 legte Thomas Mann öffentlich eine politische Kehrtwende hin. Zum 60. Geburtstag von Schriftsteller-Kollege Gerhart Hauptmann stellte er sich am 13. Oktober 1922 in seiner Rede »Von deutscher Republik« klar hinter die Weimarer Republik und bekannte sich zur Demokratie.
Deutlich erhob er in den folgenden Jahren die Stimme gegen autoritäre Tendenzen: 1930 erschien die Erzählung »Mario und der Zauberer«, die als Warnung vor totalitären Strukturen gelesen werden kann. Besorgt über den Stimmenzuwachs der NSDAP bei der Reichstagswahl 1930, warnte er in seinem »Appell an die Vernunft« vor den Nationalsozialisten.
Scharfe Kritik aus den USA
1933 kehrte Mann von einer Europa-Reise nicht nach Deutschland zurück und zog zunächst in die Schweiz. 1936 entzogen ihm, der sich als durch und durch deutsch verstand, die Nazis die Staatsbürgerschaft. 1938 emigrierte Mann in die USA. Von dort aus wandte er sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in monatlichen Radioansprachen in der BBC 55 Mal an »Deutsche Hörer!«.
Manns Verhältnis zu den Deutschen blieb auch nach dem Krieg gespannt: Als seine BBC-Reden in Buchform erschienen, wurde einem breiten Leserkreis bewusst, wie sehr der Nobelpreisträger der verbreiteten Selbsteinschätzung eines verführten, leidenden Volkes widersprach. Der Schriftsteller verwies auf die »Lager von Auschwitz und Birkenau«, erwähnte »Menschenknochen, Kalkfässer, Chlorgasröhren« und »Haufen von Kleidern und Schuhen«, darunter viele von Kindern. »Und da wundert ihr Deutschen euch, entrüstet euch sogar darüber, daß die zivilisierte Welt beratschlagt, mit welchen Erziehungsmethoden aus den deutschen Generationen, deren Gehirne vom Nationalsozialismus geformt sind, aus moralisch völlig begrifflosen und mißgebildeten Killern also, Menschen zu machen sind?«
Im 1947 erschienenen Roman »Doktor Faustus« analysierte Mann die deutsche Kultur und ihre Abwege in den Nationalsozialismus literarisch. Der Dichter, seit 1944 US-Staatsbürger, ließ sich derweil 1952 dauerhaft in Zürich nieder, nachdem er vom Ausschuss für unamerikanische Tätigkeit kommunistischer Gesinnung verdächtigt wurde. Erst 1949 bereiste er Deutschland aus Anlass von Goethes 200. Geburtstag. Leben wollte er dort allerdings nicht mehr.