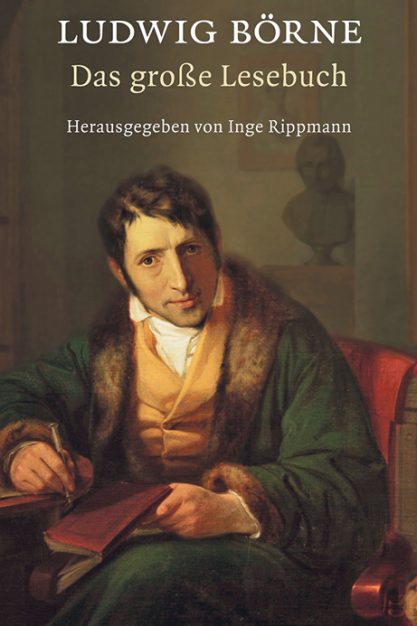Die schlimmen Zustände in der alten Frankfurter Judengasse hat Goethe naserümpfend beschrieben. Einer, der dort geboren wurde und aufwuchs, erlebte die Zerstörung des Ghettos im Juli 1796, als die Judengasse von napoleonischen Truppen beschossen und in Trümmer gelegt wurde, als Chance für die Entfaltung seiner Fähigkeiten. Ludwig Börne, 1786 als Juda Löb Baruch geboren, wurde einer der Begründer des politischen Feuilletons, im steten Kampf gegen die Zensur in den damals zahlreichen deutschen Landen. Nach seinem Tode vor 175 Jahren – er starb am 12. Februar 1837 im Pariser Exil – fiel Börne bald in eine der Restauration geschuldete, von Ignoranz geduldete, später vom Antisemitismus geforderte Vergessenheit. Allenfalls seine Kontroverse mit Heinrich Heine – bei Lichte betrachtet ein überbewerteter und oft ungenau dargestellter Nebenaspekt im Leben und Schaffen beider – blieb in Erinnerung.
zensur Frühere Ausgaben von Börnes Werken sind längst vergriffen. Umso verdienstvoller, dass die Reihe Fischer Klassik mit dem soeben erschienenen Band Ludwig Börne. Das große Lesebuch jetzt eine repräsentative Auswahl von Börnes Schriften vorlegt, die die ganze Vielfalt seines publizistischen Wirkungsfeldes dokumentiert. Inge Rippmann, seit Jahrzehnten die maßgebliche Börne-Forscherin, hat die Auswahl besorgt und eine knappe, sehr hilfreiche Einführung geschrieben.
Das Buch ist in 15 thematische Abschnitte gegliedert, die vom Generationenkonflikt Börnes mit seinem Vater bis zu den Briefwechseln mit seinen Förderern Cotta, dem Verleger Goethes, und Campe, dem Verleger Heines, reichen. Der jüdische Feuilletonist war zu seinen Lebzeiten ein gefragter Autor und publizierte bei den ersten Adressen der damaligen Verlagswelt. Oft stürzte er dabei seine Herausgeber in Konflikte mit der Zensur. Als überzeugter Demokrat, als einer der Ersten, der in Deutschland Pressefreiheit forderte (»die öffentliche Meinung … eine Volksbewaffnung«), als Exilant in Paris sowohl ein deutscher Patriot wie ein früher Europäer, als scharfer Literatur-, Theater- und Musikkritiker – immer schlug Börne eine scharfe Klinge. Köstlich ist seine Monographie der deutschen Postschnecke, die er als Beitrag zur Naturgeschichte der Mollusken und Testaceen an der Zensur vorbeischmuggelte.
aktualität Der Besetzung durch das napoleonische Frankreich – den deutschen Patrioten eine Initialzündung für den Einheitsgedanken – hatte für Börne auch Aspekte des zivilisatorischen Fortschritts. Nicht zuletzt wegen der von der Besatzungsmacht gesetzlich verankerten Gleichberechtigung der Juden, die im Zuge der Metternichschen Restauration wieder zurückgenommen wurden.
Die Kostproben, die dieses Lesebuch bereithält, sind zuweilen von frappierender Aktualität und lassen im Vergleich manches Feuilleton der Gegenwart – auch das von angesehenen »Edelfedern« – verblassen. Börnes Texte vermitteln vor allem einen Eindruck von dem, was im Vormärz für möglich gehalten und später, nach der gescheiterten Revolution von 1848, so dramatisch verspielt wurde. Vor allem aber sind sie Beispiele für das literarische Niveau der scharfen Formulierung, für die Kraft der Satire, für die Möglichkeiten, aus tagesaktuellem Anlass allgemeingültige Forderungen abzuleiten.
Ludwig Börne ist ein Klassiker des kritischen politischen Feuilletons. Vielleicht ist er in Deutschland deshalb fast vergessen worden. Sein Genre eignet sich nicht zur Zierde des bildungsbürgerlichen Bücherschranks – auch wenn es ihn demokratisch veredeln würde.
»Ludwig Börne. Das große Lesebuch«.
Hrsg. von Inge Rippmann. Fischer Klassik, Frankfurt am Main 2012, 335 S., 12 €