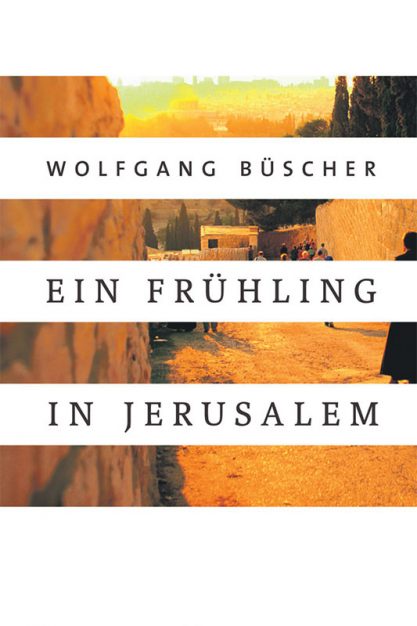Wer sich einmal nachts auf die Stadtmauer des alten Jerusalem geschlichen und vom Damaskustor herunter in die glimmenden Lichter geschaut hat, der weiß, was Wolfgang Büscher meint, wenn er vom Magnetismus dieser Stadt spricht. Aus einem Meer von Dächern erhebt sich der Tempelberg, darauf die goldene Kuppel des Felsendoms. Ein Ort, der auch nach Tausenden von Jahren noch nichts von seiner explosiven Anziehungskraft eingebüßt hat, schimmert sehnsuchtsvoll und bedrohlich zugleich in den schwarzen Nachthimmel.
altstadt Büscher hat zwei Monate lang in Jerusalems Altstadt gelebt. Zunächst in einem palästinensischen Hostel am Jaffator, später in einem griechischen Konvent aus der Kreuzritterzeit. Acht Wochen lang bewegte er sich durch die engen Gassen der Heiligen Stadt, wo Morgenland und Abendland enger beieinander liegen als irgendwo sonst auf der Welt.
Büschers bisherige Arbeiten wie Berlin–Moskau. Eine Reise zu Fuß (2006) oder Heartland. Zu Fuß durch Amerika (2011) gehören zum Besten, das die aktuelle deutsche Reiseliteratur zu bieten hat. Nicht umsonst hat der Autor zahlreiche Preise erhalten. Auch sein neuestes Buch Ein Frühling in Jerusalem, das vor zwei Monaten bei Rowohlt Berlin erschienen ist, ist ein ambitioniertes Projekt. Wobei Büscher selbst weiß, dass der Versuch, eine Stadt wie Jerusalem zu verstehen, selbst für deren älteste Bewohner ein schier unmögliches Unterfangen wäre. Kein Wunder also, dass sein armenischer Stadtführer sich nur ein müdes Lächeln abringen kann, als er ihm von seinem Vorhaben erzählt.
Dass dennoch ein wunderbares Buch dabei herausgekommen ist, liegt an Büschers Gabe, sich den Orten, die er besucht, den Menschen und ihren Geschichten mit dem unbefangenen, aber empathischen Blick des geschulten Reporters zu nähern. Er bewegt sich durch die Menschenmassen des alten Basars, wo er dem Treiben der Händler und Touristen eine gewisse routinehafte Tristesse attestiert, sitzt auf einer Bank in der Grabeskirche und beobachtet die drängelnden Pilger. Dann steigt er auf zu den Dächern der Stadt, um sich zu befreien aus dem Wirrwarr der Gassen und seinem Blick Klarheit zu verschaffen.
sehnsucht Jerusalem ist ein Kulminationspunkt der Kulturen und Weltreligionen, ein unendliches Durcheinander aus orientalischen Christen, papstreuen Katholiken, orthodoxen Juden, frommen Muslimen und patriotischen Israelis. Ein Sehnsuchtsort, dessen mehrtausendjährige Geschichte nicht von seiner explosiven Gegenwart zu trennen ist. »Wäre Jerusalem eine Bombe, der Tempelberg wäre ihr Zünder«, schreibt Büscher an einer Stelle. Die große Stärke des Buches ist es, dass der Autor gar nicht erst versucht, diese Widersprüche aufzulösen. Er gibt sich ihnen hin.
Sein armenischer Stadtführer, den er »Charly Effendi« nennt, ist ein melancholischer Ureinwohner der alten Mauern, Rudiment einer muslimisch-christlich-jüdischen Bohème, deren Blütezeit spätestens mit dem britischen Mandat 1948 zu Ende ging. Seine Familie wurde im Unabhängigkeitskrieg 1948 aus einem christlichen Villenviertel im Westteil Jerusalems in die jordanische Altstadt vertrieben. Ähnlich bei Büschers jüdischer Freundin Ada: Ihre Familie verlor damals ihr Haus im jüdischen Viertel der Altstadt. Die Leidtragenden der Auseinandersetzungen um Jerusalem waren und sind immer die Bewohner der Stadt, gleich welcher Religion und Volksgruppe sie angehören.
Den Frieden in der Stadt beschreibt Wolfgang Büscher als ein randvolles Glas Milch in der Hand eines dreijährigen Kindes, das jederzeit herunterfallen und zerbrechen kann. Dass das Zusammenleben trotzdem funktioniert, liegt für ihn an der »schönen Jerusalemer Arroganz« – der Fähigkeit jedes einzelnen Bewohners der Stadt, Teil eines Schauspiels zu sein, bei dem man den anderen bisweilen ignoriert. Um des Friedens willen.
Wolfgang Büscher: »Ein Frühling in Jerusalem«. Rowohlt, Berlin 2014, 234 S., 19,95 €