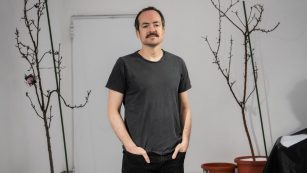Wer hat die Welt erschaffen – woher kommen wir, und was ist nach dem Tod? Gibt es ein höheres Wesen, das alle Geschicke lenkt, oder ist eine »allumfassende Macht« nur Illusion? Seit Urgedenken ringt die Menschheit mit den großen Fragen des Daseins. Dem widmet sich zurzeit im Jüdischen Museum Wien eine Ausstellung, die noch bis Anfang Oktober zu sehen ist. Der Titel: G*tt. Die großen Fragen zwischen Himmel und Erde.
Sieben Räume, die durch Sichtachsen miteinander verbunden sind, gehen je einer dieser Fragen nach: »Was macht G*tt?«, »Wo wohnt G*tt?« oder »Wie zeigt sich G*tt?«, heißt es da zum Beispiel. Die Ausstellung schlägt den Bogen von jüdischen Gottesvorstellungen in biblischer Zeit bis in die Gegenwart. Anhand historischer Ritualobjekte und zeitgenössischer Kunstwerke entsteht ein Dialog zwischen der religiösen Tradition und existenziellen, abstrakten Themen – ein Gespräch, in das der Besucher im Stillen einsteigen kann.
Von der Decke hängen offene Schriftrollen
Das Foyer der Ausstellung empfängt mit von der Decke hängenden offenen Schriftrollen, auf denen Zitate bedeutender Gelehrter der Antike, des Mittelalters und der Moderne zu lesen sind: »Unter Gott verstehe ich das absolut unendliche Wesen … Alles, was ist, ist Gott, und nichts kann ohne Gott sein noch begriffen werden«, wird Baruch de Spinoza zitiert. Oder sehr nüchtern Albert Einstein: »Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwäche.«
Dass die Räume tiefblau gestrichen und bei Weitem nicht voll gestellt sind, verstärkt die Wirkung der wenigen Objekte.
In den Räumen, die den sieben Fragen nachgehen, wird ebenfalls mit Zitaten gearbeitet. Jeder Raum (außer dem letzten) steht im Zeichen eines biblischen Verses, der sich auf die jeweilige Frage bezieht und den Besucher offenbar intellektuell anregen möchte. So ist dort, wo die Frage nach dem Wohnort Gottes aufgeworfen wird, an die Wand appliziert: »Der Herr donnerte vom Himmel herab« (Psalm 18,14). Und im Raum »Wie heißt G*tt?«, in dem es um die Gottesnamen geht, liest man: »Ich bin der ›Ich bin da‹« (2. Buch Mose 3,14).
Prägnant ist auch der Vers in dem Raum mit der Frage, wie sich Gott zeigt: »Du kannst mein Angesicht nicht sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben« (2. Buch Mose 33,20), steht dort an der Wand.
Daneben hängt ein Ölgemälde von R.B. Kitaj, einem der wichtigsten Vertreter der britischen Pop-Art. Es zeigt in der Mitte eine große weiße Fläche, die Bezug nehmend auf den Toravers Gottes Rücken zeigen soll – denn Moses, nach der biblischen Überlieferung der einzige Mensch, der Gott jemals sah, erblickte den Ewigen lediglich von hinten. Und daneben ein Werk von Georg Chaimowicz mit dem Titel »Die weiße Leere« (1974), ein gerahmtes leeres Blatt Papier, das der Wiener Künstler signiert hat – eine Referenz an das göttliche Bilderverbot. Der Idee, dass Gott nicht zu sehen ist, steht die menschliche Vorstellung vom Auge Gottes gegenüber, das alles sieht.
Verweise auf andere Religionen
Die Ausstellung illustriert dies anhand einer Acrylarbeit der New Yorker Künstlerin Yona Verwer von 2023. Weil die Schau aber nicht nur jüdische Besucher ansprechen möchte, seien auch sogenannte Komparativobjekte zu sehen, also Verweise auf andere Religionen, erklärt Daniela Schmid, eine der beiden Kuratorinnen. So wird zum Beispiel aus der Barockzeit eine katholische Hostienmonstranz gezeigt, die ebenfalls das Auge Gottes als Symbol enthält.
»Bei der Auswahl der Objekte war uns wichtig zu betonen, dass Gottes Schöpfung auch eine ästhetische Komponente hat«, sagt Schmid. So gebe es das Gebot, die Tora zu schmücken. In einem der Räume zeigt die Ausstellung deshalb eine mit Edelsteinen verzierte goldene Torakrone – »echte Materialität betont die Verehrung der Tora«, so die Kuratorin.
»Wir sind eine wissenschaftliche Institution und keine Jeschiwa«, betont die Kuratorin.
Dass die Räume tiefblau gestrichen und bei Weitem nicht voll gestellt sind, verstärkt die Wirkung der wenigen Objekte. Schaut man genau hin, lässt sich erahnen, dass es zwischen den Blautönen der sieben Räume feine Unterschiede gibt – eine Referenz an die Schattierungen des Himmels. Auch sonst steckt die Ausstellung voller symbolischer Details. So stehen an den Wänden locker aufgeschichtete Reihen moderner Ziegel – ein Hinweis auf die irdische Sphäre und den Erbauer der Welt. Ein sehr gelungenes Zusammenspiel.
Warum im Titel Gott offenbar gegendert ist, wird nirgendwo explizit erklärt. Das Gendern sei lediglich ein Nebenaspekt, sagt Daniela Schmid. Vor allem sei das Sternchen als Platzhalter gedacht, weil es im Judentum nicht üblich ist, den Gottesnamen auszusprechen. Fragt man die Kuratorin, warum »Gott« dann aber, anders als im Titel, in den Texten innerhalb der Ausstellung ausgeschrieben wird, antwortet sie knapp und plausibel: »Wir sind eine wissenschaftliche Institution und keine Jeschiwa.«
Es geht der Ausstellung nicht darum, Menschen zu Gott zu führen. Vielmehr eröffnet sie die Möglichkeit, sich emotional, intellektuell und sinnlich – manches darf man, ja soll man anfassen – mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Schlenderte der Museumsbesucher gerade noch durch die Gassen der Wiener Innenstadt mit ihren Kaffeehäusern und Geschäften, taucht er hier, im Palais Eskeles, ein in die tiefen Schichten des menschlichen Bewusstseins. Eine exzellente Schau, der man viele Besucher wünscht.
Bis zum 5. Oktober im Jüdischen Museum Wien