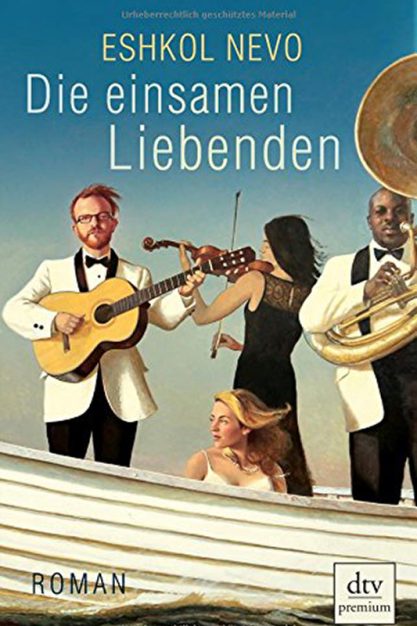Seit seine Frau gestorben ist, sucht Jeremiah Mandelsturm vergebens nach einem Sinn im Leben. »Ein Tag klebt am anderen, nicht einmal der Mammon, an dessen Anhäufung ich all die Jahre Tag und Nacht gearbeitet habe, ist mir mehr Anreiz«, schreibt der Witwer aus New Jersey in einem Brief nach Israel. Um diesem Elend zu entgehen, habe er sich überlegt, in Erinnerung an seine Frau in der sogenannten Stadt der Gerechten eine Mikwe bauen zu lassen.
Das ist der Ausgangspunkt des neuen Buches von Eshkol Nevo. Der 44-jährige Schriftsteller ist in Israel Bestsellerautor, und auch in Deutschland wächst der Kreis seiner Fans. Nach Vier Häuser und eine Sehnsucht (2007), Wir haben noch das ganze Leben (2012) und Neuland (2013) ist Ende Februar sein vierter Roman in deutscher Übersetzung erschienen: Die einsamen Liebenden. Anders als die Vorgänger, die bei aller Leichtigkeit durchaus einen ernsten Grundton anschlugen, ist das neue Buch eine Realsatire, die gegen Ende mehr und mehr märchenhafte Züge annimmt.
Neueinwanderer Der Titel der hebräischen Originalausgabe lautet HaMikwe haAcharon be Sibir, was so viel wie »Die letzte Mikwe in Sibirien« heißt. »Sibirien« nennen die Bewohner der fiktiven Stadt der Gerechten abfällig das Viertel Ehrentreu, eine Art Ghetto, in dem ausschließlich Neueinwanderer aus der früheren Sowjetunion wohnen. Das Leben in »Sibirien« spielt sich auf Russisch ab, die meisten Leute dort sind Rentner, verstehen kein Hebräisch, wissen so gut wie nichts übers Judentum, und noch keiner war jemals in einer Mikwe.
Doch ausgerechnet dort soll das neue Tauchbad entstehen, das Jeremiah Mandelsturm der Stadt der Gerechten schenken will. Ein anderer Ort komme nicht infrage, sagt Mosch Ben Zuk, der persönliche Assistent des Bürgermeisters, »wir haben bereits die höchste Mikwendichte im gesamten Nahen Osten aufzuweisen, pro Quadratmeter und auch pro Kopf«. Doch will man den amerikanischen Wohltäter nicht verprellen, denn man erhofft sich weitere Wohltaten. Und so wird aus der Not eine Tugend: Der Bürgermeister antwortet Mandelsturm, er dürfe sich glücklich schätzen, mit seiner Mikwe fördere er die religiöse Erziehung der Neueinwanderer.
Die sind tatsächlich begeistert von dem Bauprojekt. Endlich errichtet ihnen die Stadt ein Klubhaus – glauben sie. Als das Gebäude steht, kommen sie mit Schachbrettern unterm Arm und nehmen es in Besitz. Allerdings wundern sie sich über die gekachelten Räume und die Duschen, die das Gebäude in ihren Augen wie eine Banja, ein russisches Badehaus, aussehen lassen.
Doch bis zur fertigen Mikwe ist es ein weiter Weg.
Empathisch Detailliert beschreibt Nevo das Baugeschehen und erzählt vom skurrilen Leben in der Stadt der Gerechten. Auch diesmal erweist er sich als Meister im Zeichnen der Charaktere. Möglicherweise hilft ihm, dass er, bevor er mit dem Schreiben anfing, Psychologie studiert hat. Voller Empathie seziert er das Gefühlsleben seiner Protagonisten, die, wie so oft in seinen Büchern, Suchende sind, voller Sehnsucht und Träume.
In seinem neuen Roman kommt hinzu, dass es sich, wie der Titel verrät, um einsame Liebende handelt: Da ist Mosche Ben Zur, der als Waisenkind in einen Kibbuz kam, aber dort nie wirklich akzeptiert wurde, sondern immer »ein Externer« blieb. Er macht Karriere beim Militär, wird religiös, heiratet, seine Frau bekommt zwei Kinder – doch seine Ehe ist nicht sein Zuhause. Denn seit einiger Zeit spürt er in den Straßen der Stadt immer wieder den Geruch seiner ehemaligen Freundin Ayelet, die sich vor Jahren unter tragischen Umständen von ihm getrennt hat.
Auch sein Chef, Bürgermeister Avraham Danino, erlebt schwere Ehejahre, wird von seiner Frau abgelehnt, leidet unter Einsamkeit. Einsam – und allein gelassen – fühlen sich auch die Neuzuwanderer in Ehrentreu, für deren Bedürfnisse sich die Stadtverwaltung nicht die Bohne interessiert. Fernab ihrer gewohnten Umgebung klammern sie sich aneinander, um mit dem neuen Leben zurechtzukommen.
Liebe Vor allem einen von ihnen zeichnet Nevo sehr detailliert und äußerst feinfühlig: den depressiven russischen Rentner Anton, der gern Akademiker geworden wäre, aber aus politischen Gründen in der Sowjetunion nicht studieren durfte, der kein Jude ist, nur seiner Frau Katja zuliebe mit nach Israel auswanderte und der sehr darunter leidet, dass ihm die körperliche Liebe mit ihr nicht möglich ist.
Gekonnt verschränkt Nevo mehrere Erzählstränge und zeichnet fast liebevoll das Innenleben seiner Protagonisten. Jedes Kapitel hat seinen eigenen Haupthelden, aus dessen Perspektive Nevo die Geschichte vom Bau der Mikwe erzählt und dabei auch das Gefühlsleben des jeweiligen Protagonisten enthüllt. Das geschieht sehr feinsinnig und taktvoll, man möchte fast sagen, in einer Art geschütztem Raum. Trotzdem ist Eshkol Nevos neuer Roman über weite Strecken ein witziges Buch. Denn die Mikwe, so viel sei verraten, erweist sich als ein Ort, der, so munkelt man in Ehrentreu, sexuell aufgeladen ist.
Eshkol Nevo: »Die einsamen Liebenden«. Roman. Übersetzt von Anne Birkenhauer. dtv, München 2016, 300 S., 16,90 €