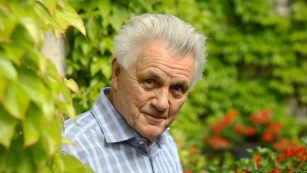Eigentlich hatte die Geschichte dieses Buches, Kleiner Versager, woanders angefangen, in einem Büro des amerikanischen Abosenders HBO. Gary Shteyngart sollte eine Serie entwickeln, was auch und besonders in den Staaten ein Ritterschlag für jeden Schriftsteller ist. Denn nicht nur die Honorare und Erfolgsaussichten werden dadurch viel größer, mit einem Schlag verzehnfacht sich auch das Publikum.
Der Deal mit HBO platzte, aus unbekannten Gründen. Vielleicht war die Liebe der Amerikaner zu den ureigenen Geschichten der Immigranten doch nicht so groß. Was es auch immer war: Gary Shteyngart machte aus seinem Pitch ein Buch und aus den Dialogen seine Autobiografie. Wenn man das weiß, lesen sich seine Kindheitserinnerungen tatsächlich wie ein schon vorgeschnittenes Script, angefangen beim 30-jährigen Shteyngart, der neben seinem Bürojob zu viel trinkt und davon träumt, ein bedeutender Schriftsteller zu werden.
russland Das ist so ein Bild, das man aus Filmen kennt: Ein Mann, gefangen im Selbsthass und einem unbefriedigenden Beruf, schaut in einer Buchhandlung die zukünftigen Konkurrenten an (junge Schriftsteller, die historische Megaromane schreiben) und bleibt doch bei einem Reiseführer über St. Petersburg hängen, in dem die russische Tristesse mit subversiver westlicher Ideologie beschrieben wird.
Für einen russisch-jüdischen Immigranten sind vor allem diese zwei Dinge wichtig: Bücher und die russische Heimat. In Büchern steht die Weisheit, und das Schreiben ist eine heilige Tätigkeit. Und vielleicht beginnt Shteyngart deshalb gleich mal mit dem Allernötigsten, also dem, was er als Kind lernen musste: »Dieses Bekenntnis habe ich mir selbst gegeben: Stunde null. Ein Neuanfang. Den Zorn im Zaum halten. Versuchen, die Wut vom Humor zu trennen. Über Dinge lachen, die nicht dem Schmerz entspringen.«
Die frühesten Jahre, die wichtigsten, sind eben die schwierigsten. Aus dem Nichts auftauchen braucht seine Zeit. In dem Russland, in dem Shteyngart aufwächst, ist die optimistische Tauwetterstimmung unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow längst verflogen, und unter der zunehmend starren Führung des Leonid Breschnew beginnt die Sowjetunion ihren rapiden Abstieg ins Bodenlose. Die Millionen von Toten im Hintergrund konnte auch dieses Land nicht verkraften. »›Warum hatte ich vor allem so große Angst?‹, frage ich meine Mutter fast 40 Jahre später. ›Weil du als jüdischer Mensch geboren wurdest‹, sagt sie.«
ironie Das sind die sehr starken und interessanten Stellen bei Shteyngart, weil man ihn ja noch gar nicht so richtig kennt, weil ein Gary Shteyngart eben gelernt hat – wie sehr viele jüdische Einwandererkinder –, zwar sein Außenseitertum zu thematisieren, dieses aber im Grunde unter einer dicken Schicht Ironie begräbt. Vielleicht war es auch das, was an Shteyngart immer ein wenig stört: der bemühte Witz eines Erwachsenen, dessen pseudo-anzeigerischer Selbsthass mitunter nur ein abgequälter Humor für Depressive ist. Man sieht Gary Shteyngart also anfänglich und auch immer wieder zwischendrin, als könne er sich diesen Pseudofrust gar nicht verkneifen, als eine unangenehme Person.
Aber zurück zu dem verletzlichen Kind, das Shteyngart – seine Mutter nennt ihn seit Jahrzehnten zärtlich-verletzend »Failurchka« – ungeheuer einfühlsam und witzig beschreiben kann. Dieses Kindsein, Fremdsein, Absurdsein. So gibt er sich, in New York mit seiner Familie angekommen, lieber als ostdeutscher Jude aus denn als Russe. Und während er in seinen, für ihn peinlichen Anziehsachen in die Schule rennt, liegt neben seinem Vater eine Videokassette mit dem Titel »Einwanderung: Gefahr für den Zusammenhalt unserer Nation: Teil II: Betrug und Verrat in Amerika«, produziert von einer rechtsextremen kalifornischen Gruppierung.
Auch sein Name macht ihm Probleme. Als er sich einmal damit beschäftigt, stellt sich heraus, dass sich Shteyngart von Steinhorn ableitet, und wenn man seinen eigentlichen Vornamen davor setzt, klingt es wie ein bayerischer Pornostar: Igor Steinhorn.
Anerkennung Viel später, Shteyngart ist längst ein berühmter Schriftsteller und laut dem Magazin New Yorker unter den 40 besten Autoren der USA irgendwo auf Platz 30 gelandet, lädt er seine Mutter am Times Square zu ihrem Geburtstag zum Essen ein. Am Tisch die halbe Familie. Man geht die Liste der Schriftsteller durch und fragt Gary, warum er so schlecht platziert sei und zitiert einen russischen Blogger, der Gary nur das Schlimmste wünscht. »Tante Tanja will sich für mich starkmachen und tut ihre Meinung kund: ›Sie schreiben zwar, dass du bald vergessen sein wirst, aber viele Schriftsteller finden erst nach ihrem Tod Anerkennung.‹ Mein Vater nickt.«
Aber kann jemand vergessen werden, den – trotz seiner Weltbestseller – eigentlich niemand richtig kennt? Shteyngart hat keinen richtigen Platz in der US-Literatur, und das hat ausnahmsweise nichts mit dem eingedruckten »jevrej« im alten Sowjetpass zu tun. Er ist etwas jünger als die Jonathan Franzens, die vor ihm die hypersmarten It-Boys der amerikanischen Literatur waren. »All the sad young literary men« hat Keith Gessen in einem Roman 2008 diese Cliquenbildung mal beschrieben – Gessen ist wie Shteyngart russischstämmiger Jude. Sie müssen ihre Geschichten nicht mit Ellis-Island-Schatten würzen, sondern haben unmittelbare Erfahrung von stickigen Immigration Offices mit verbranntem Kaffee und lauwarmen Bürokarten.
In seinem ersten Roman mit dem vielleicht zu passenden Titel The Russian Debutante’s Handbook zeigte er diese Welt im Zerrspiegel. Sein zweiter Roman Absurdistan drehte die Konstellation um und präsentierte einen übergewichtigen und komplett amerikanisierten Millionärssohn, der in St. Petersburg festsitzt. Und im dritten Buch Super Sad True Love Story, seinem größten Erfolg, sind die meisten ethnischen Querelen durch Ökonomisierung von Kommunikation verdeckt.
Parodien Doch es sind nicht irgendwelche Bindestriche in der Identität, die Shteyngart ausmachen – es ist die Tatsache, dass er ein sehr guter Leser ist. Aber selbst das muss er ironisieren und YouTube-Parodien über seine Angewohnheit drehen, Kollegen positive Klappentexte für ihre neuen Bücher zu liefern.
Dennoch hat Kleiner Versager am meisten Wert, wenn es um ein Leben geht, das anhand und entlang von Büchern gelebt wird. Dass von diesem erzählten Leben am Ende wenig mehr übrig ist als neurotische Pose: geschenkt. Shteyngarts Heimat ist die Selbstironie. Er wird schon wissen, warum er keinen Ausreiseantrag stellt.
Gary Shteyngart: »Kleiner Versager«. Rowohlt, Reinbek 2015, 480 S., 22,95 €