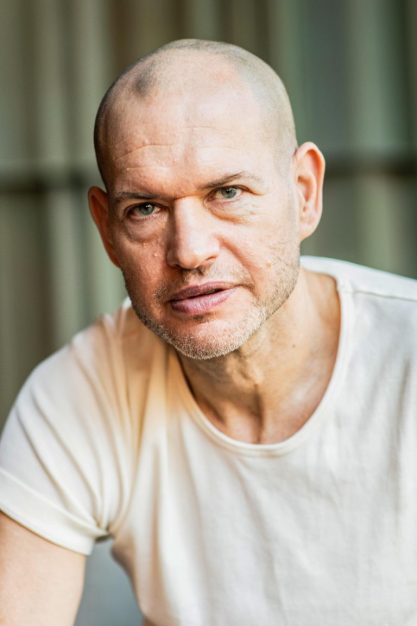Eine Party in einer luxuriösen modernen Villa irgendwo in Tel Aviv. Es wird getanzt und gefeiert, getrunken und gesungen, als gäbe es keinen Krieg und auch kein Morgen. Unter den Gästen, zu denen neben den Reichen und Mächtigen auch hohe Militärs der israelischen Armee und wahrscheinlich auch der eine oder andere Rabbiner gehören, befinden sich der Pianist und Comedian Y sowie dessen Partnerin, die Tänzerin Yasmin. Sie wurden engagiert, die Stimmung zu verstärken, den Rausch in Exzess und Delirium zu treiben.
Wie Y (Ariel Bronz) immer lauter singt, wie er sich zwischen den Feiernden durchschlängelt, wie er sich in den Pool fallen lässt und schließlich in eine Art Gesangs-Battle mit dem Generalstabschef verstrickt, hat etwas Manisches. Man kann sich nie ganz sicher sein: Ist das nun eine irrwitzige Performance oder ein Versuch, sich selbst auszulöschen? Die fiebrige Intensität der Party wie auch der Performance, die der israelische Filmemacher Nadav Lapid in langen Kamerafahrten und desorientierenden Schnitten einfängt, etabliert von Anfang an ein Gefühl von Haltlosigkeit.
Yes, Lapids fünfter und 150 Minuten langer Spielfilm, ist ein einziger Taumel. Momente der Ruhe und des Innehaltens sind selten. In ihnen würden sich Wahrheiten offenbaren, vor denen man lieber flieht, mal in Partys, mal in Zynismus, mal in Nationalismus und mal in Verzweiflung.
Lapid stellt sich in eine künstlerische Tradition mit George Grosz
Kurz bevor Yasmin (Efrat Dor) und Y die Party mit einer reichen älteren Frau verlassen und sich durch deren Befriedigung etwas dazuverdienen, entdeckt der Musiker einen Ausstellungskatalog und damit ein Bild. In seinem Ölgemälde »Stützen der Gesellschaft« von 1926 hat George Grosz die politischen und gesellschaftlichen Zustände in der Weimarer Republik auf bitterböse, sarkastische Weise seziert.
Das ist natürlich kein Zufall. Lapid stellt sich voller Selbstbewusstsein in eine künstlerische Tradition mit Grosz. Zugleich reicht er dem Publikum eine Art Schlüssel zum Verständnis seiner wilden Ästhetik.
Die in drei Kapiteln erzählte Geschichte von Y und Yasmin, die das Land verlassen will, ist kein realistisches Porträt Israels nach dem 7. Oktober 2023. Lapid hat sich entschieden, die Verhältnisse zu überzeichnen und alles auszublenden, was seine nicht um Mäßigung und Ausgleich bemühte, sondern von fast heiligem Zorn erfüllte Darstellung Israels komplizieren würde. Es gibt keine Bilder der Proteste gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu und ihre Form der Kriegsführung in Gaza. Es gibt keine Perspektive für die Protagonisten, in Israel zu bleiben und etwas zu verändern.
Rechtsextreme Neufassung des »Freundschafts«-Liedes
Einmal erklärt Y seinem einjährigen Sohn Noah, dass Unterwerfung Glück bedeute und es nur zwei Worte gebe: »Ja« und »Nein«. Y hat sich für das »Ja« entschieden, auch zu dem Auftrag eines aus Russland stammenden Milliardärs, eine »neue israelische Nationalhymne« zu komponieren. Der schreckliche Text dazu existiert wirklich, er ist eine rechtsextreme Neufassung des »Freundschafts«-Liedes, das der Dichter und Palmach-Kämpfer Haim Gouri 1949 in Erinnerung an die Gefallenen des Unabhängigkeitskrieges schrieb.
Die »Neudichtung« entstand nach dem 7. Oktober. Im dazugehörigen Video der nationalistischen »Bürgerfront« kündigt ein Kinderchor mit Engelsstimmen die Auslöschung nicht nur der »Hakenkreuzträger«, sondern »aller« Menschen in Gaza an.
Im November 2023 wurde das Video von Israels öffentlich-rechtlichem Sender Kan auf X geteilt, nach scharfen Protesten aber wieder von der Website des Senders genommen. Lapid nutzt den neuen Text entgegen dem Willen von Guoris Erben.
Die Gräuel des 7. Oktober und die Bombardierung von Gaza
Eine zentrale Szene ist der Monolog von Leah (Naama Preis), der früheren Geliebten von Y, über die Gräuel des 7. Oktober. Anschließend wirft Y vom »Hügel der Liebe« im Süden Israels aus einen Blick auf die Bombardierung von Gaza. Nadav Lapid malt den Verfall einer Gesellschaft in grellsten Farben aus. So wird Yʼs Unterwerfung zur düsteren Erzählung eines Narren, der dem Wahnsinn der Gegenwart einen Rest von Sinn abgewinnen will und daran scheitert.
Lapid mag bewusst zu weit gehen und die Realität durch seine einseitige Darstellung entstellen. Aber in seiner atemlosen, von bizarren Brüchen und kaum zu erklärenden Leerstellen geprägten Ästhetik liegt eine tiefere Wahrheit über Israel nach dem Pogrom der Hamas. Genau so muss es sich anfühlen, in einem fortwährenden Albtraum zu leben. (mit ja)
»Yes« läuft ab dem 13. November in den Kinos.