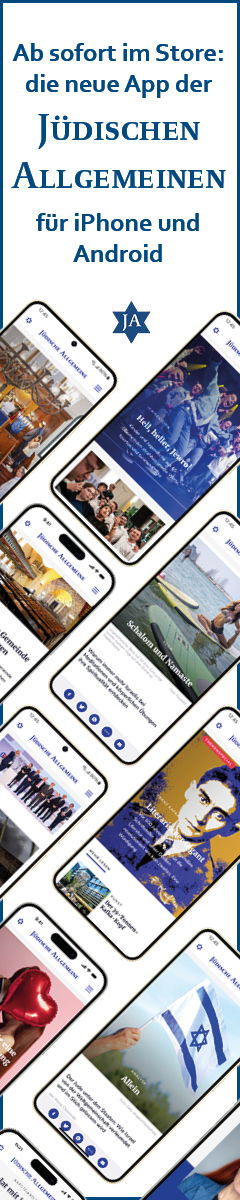Renate Lasker war die zweite von drei Töchtern der Cellistin Edith Lasker und des Rechtsanwalts Alfons Lasker aus Breslau. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Anita überlebte Renate die Nazi-Todeslager Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen. Ihre ältere Schwester Marianne war zum Beginn des Zweiten Weltkriegs bereits in London. Verzweifelte Versuche der Laskers, eine Einreisegenehmigung nach Großbritannien oder in die USA zu ergattern, wo der Bruder von Alfons lebte, scheiterten.
Im Sommer 1942 kam die Gestapo und forderte die Eltern auf, sich am frühen Morgen des folgenden Tages an einem Sammelplatz für Juden in Breslau einzufinden. Die beiden ahnten, dass sie ihre Töchter wohl nie wiedersehen würden, und beschwörten sie, unbedingt zusammenzubleiben.
PLAN Renate wurde von den Behörden zunächst zur Zwangsarbeit bei der Müllabfuhr und später – gemeinsam mit Anita – in eine Toilettenpapierfabrik beordert. Dort heckten die beiden zweisprachig erzogenen Mädchen einen Fluchtplan aus. Sie gaben sich als Französinnen aus und versuchten, mit gefälschten Ausweispapieren nach Südfrankreich zu fliehen.
Doch der Plan ging schief: Am Breslauer Bahnhof wurden beide verhaftet. Renate wurde als Erwachsene zu Zuchthaus und Anita zu einer Gefängnisstrafe verurteilt – wegen Urkundenfälschung, auch zugunsten französischer Kriegsgefangener. Beide entgingen so zunächst einer Deportation in die Todeslager, wurden aber voneinander getrennt.
»Das sind deine Eltern, die da durchgeblasen werden«, rief man ihr in Auschwitz mit Blick auf das Krematorium zu.
Die Haftstrafen rettete ihnen wahrscheinlich das Leben, meinten sowohl Anita als auch Renate rückblickend. »Es war damals besser, ein Verbrecher zu sein als ein Jude«, so Lasker-Wallfisch. Auch ein gemeinsamer Selbstmordversuch ging schief – ein Freund hatte das Giftpulver, mit dem die jungen Frauen ihrem Leben ein Ende setzen wollten, gegen etwas Harmloses ausgetauscht.
AUSCHWITZ Im Dezember 1943 wurde Anita, eine äußerst begabte Cellistin, aus dem Gefängnis nach Auschwitz deportiert. Dort wurde sie als Cellistin in das Lagerorchester eingeteilt und entging so der Zwangsarbeit. Eine Woche später wurde auch Renate vom Zuchthaus Lauer nach Auschwitz deportiert. »Ich hatte zuvor noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen«, berichtete Lasker-Harpprecht im Jahr 2016 bei einer Veranstaltung des Jüdischen Museum Berlin.
Irritiert vom Anblick des dichten Rauchs, der aus den Schornsteine der Krematorien quoll, riefen einige polnische Mitgefangene ihr zu: »Das sind deine Eltern, die da durchgeblasen werden.« Das seien ihre ersten Eindrücke von Auschwitz gewesen«, sagte Lasker-Harpprecht später.
Die Journalistin produzierte für die BBC und den WDR Fernsehfilme, schrieb Artikel und veröffentlichte 1974 den Roman »Familienspiele«.
Per Zufall entdeckte sie bei der Ankunft im Lager Anitas Schuhe, die dieser zuvor abgenommen worden waren. So erfuhren die Schwestern voreinander. Anita gelang es, Renate zu helfen – obwohl diese gleich zu Beginn schwer krank wurde. Den Ermordungen der SS entging sie mit Glück.
Im Herbst 1944 wurden die Lasker-Schwestern gemeinsam mit anderen Häftlingen auf einen Todesmarsch geschickt, der in Bergen-Belsen endete. Dort wurden die beiden Schwestern von britischen Soldaten im April 1945 befreit.
ROMAN Während Anita nach London ging, arbeitete Renate Lasker zunächst als Sekretärin und später als Sprecherin für die britische BBC und anschließend für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Die Journalistin produzierte auch Fernsehfilme, schrieb Artikel und 1972 den Roman Familienspiele. Zu ihren Erfahrungen in der NS-Zeit wurde sie zu dieser Zeit selten befragt. Im hohen Alter berichtete die Überlebende dann aber vor französischen Schulklassen von ihren Erlebnissen während der Nazi-Zeit.
1967 schaffte Lasker-Harpprecht es in einem Interview, dem hessischen Staatsanwalt Fritz Bauer zahlreiche Details aus dessen Kindheit zu entlocken. Die Tatsache, dass nicht nur Bauer, sondern auch sie selbst die Schrecken der NS-Verfolgung überlebt hatte, erwähnte sie in dem halbstündigen Gespräch mit dem jüdischen Nazi-Jäger aber mit keiner Silbe.
Schließlich berichtete Renate Lasker-Harpprecht einige Jahre lang für das ZDF aus den Vereinigten Staaten, bevor sie in den Ruhestand eintrat. Diesen verbrachte sie mit ihrem zweiten Mann, dem Journalisten Klaus Harpprecht, einem ehemaligen Redenschreiber Willy Brandts, in La Croix-Valmer an der französischen Côte d’Azur.
»Ich bin pessimistisch, was die Zukunft angeht. Es stinkt mir entsetzlich zu sehen, wie in Europa die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind. Was hat die Welt eigentlich aus Auschwitz gelernt?«
Renate Lasker-Harpprecht
Im Vergleich zu ihrer Schwester Anita war sie in den vergangenen Jahren weniger in der Öffentlichkeit präsent. Dennoch meldete sie sich immer wieder zu Wort und mischte sich in politische Debatten ein. »Ich bin pessimistisch, was die Zukunft angeht. Es stinkt mir entsetzlich zu sehen, wie in Europa die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind, wie Menschen in Afrika verhungern oder im Mittelmeer ertrinken und so viele gleichgültig wegschauen. Was hat die Welt eigentlich aus Auschwitz gelernt?«, fragte sie in einem Gastbeitrag für die Jüdische Allgemeine anlässlich des Holocaust-Gedenktags 2020.
SELBSTBESTIMMT Trotz ihrer Lebensgeschichte und ihres Pessimismus verlor Renate Lasker-Harpprecht nie den Humor. Schon zu Beginn ihrer Partnerschaft, Mitte der 1950er-Jahre, habe Renate zu Klaus Harpprecht gesagt, sie denke gar nicht daran, Hitler und seinen Schergen den Rest ihres Daseins zu opfern.
»Die eintätowierte Nummer verbirgt Renate nicht. Aber sie ist es, die bestimmt, ob sie von Auschwitz, von Bergen-Belsen, von den ermordeten Eltern, von den frühen Tagen der Kindheit in Breslau und von den Jahren der Demütigung, der Isolierung, der Entbehrung und der Gefangenschaft sprechen will, oder von den bösen Träumen, die sie heimsuchen«, schrieb Klaus Harpprecht im Vorwort zu einem Erinnerungsbuch seiner Schwägerin Anita Lasker-Wallfisch 1996.
Zehn Tage vor ihrem 97. Geburtstag ist Renate Lasker-Harpprecht nun in ihrer französischen Wahlheimat La Croix-Valmer gestorben.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema in unserer Print-Ausgabe am Donnerstag.