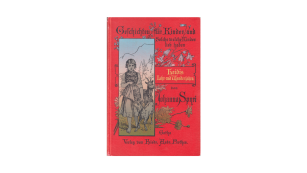Während bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen gerungen wird, kümmert sich eine neue jüdische Initiative um den Sportnachwuchs. Und manchmal passen auch verwirrende Dinge zusammen: Jeremy Moses und Eitan Levine sind eigentlich Comedians, doch haben sie gemeinsam »Tribe NIL« gegründet, die erste jüdische Initiative, um Collegesportler und -sportlerinnen mit potenziellen Sponsoren zusammenzubringen.
Die Abkürzung NIL ist im US-Sport von enormer Bedeutung. Geht es bei »Name, Image, Likeness« doch darum, dass es Athleten, die mit Stipendien an Universitäten gebunden sind, seit wenigen Jahren erlaubt ist, ihre Persönlichkeitsrechte zu vermarkten. Etwas, das ihnen mehr als 100 Jahre lang mit Hinweis auf die harschen Amateurregeln untersagt war. Seit 2021 gibt es den sogenannten NIL-Deal. Sich so zu vernetzen, ist vor allem für Athleten interessant, die zwar in ihrer Disziplin Spitze, wenn nicht sogar Weltklasse sind, deren Sport nach Ende des Studiums aber keine topbezahlte Profikarriere verheißt.
Jüdisches Gemeinschaftsgefühl
Das Besondere an »Tribe« ist, dass es nicht an eine Universität gebunden ist, sondern im ganzen Land Sportler mit Sponsoren zusammenbringen kann – wenn sie Teil der jüdischen Community sind. »Ich sage immer scherzhaft, dass jüdischer Nepotismus etwas Gutes ist«, vertraute Jeremy Moses dem Magazin »Forward« an. Soll heißen: Das, was gern als Vetternwirtschaft und Klüngel abgetan werde, sei für Sportler manchmal die einzige Chance. Eine nicht unwichtige Bedingung dabei ist, dass die Athleten »stolze« Juden sind. »Wenn sie sich nicht wohl dabei fühlen, offen über ihr Judentum zu sprechen, ist diese Organisation nicht das Richtige für sie«, so Moses.
Stützen sich andere NIL-Initiativen auf die loyale Verbindung etwa von Alumni zu ihren alten Universitäten, so setzen Moses und Levine auf das jüdische Gemeinschaftsgefühl. Zwar haben alle Fans ein Lieblingsteam, aber jüdische Fans empfinden häufig sogar eine gewisse Form des Stolzes, wenn der Star eines Teams, das sie eigentlich nicht mögen, Jude ist.
In diesem Phänomen hat Moses eine Chance erkannt. Ein jüdischer Rechtsanwalt etwa könne jüdischen Collegesportlern bezahlte Praktika anbieten und darüber hinaus Geld geben, um mit ihnen auf Social Media zu werben. Die positive Außenwirkung käme ja nicht nur zustande, weil der Praktikant Jude, sondern auch, weil er Spitzensportler ist. »Die haben schließlich einen Hochschulabschluss und spielen nebenbei noch Basketball, richtig?«, erklärt er die Formel. »Das beweist ein hohes Maß an Engagement.«
»Tribe« ist erfolgreich. Binnen eines Jahres haben sich 200 Sportler und Sportlerinnen bei Moses und Levine gemeldet – Leichtathleten, Schwimmerinnen, Feldhockeyspielerinnen und Turner, aktiv in Sportarten also, die von der alten Amateurregel besonders betroffen waren. Denn bereits, wenn man ihnen eine Pizza ausgegeben hat, drohten ihnen in der Folge Sanktionen.
Schon rund 200 Verträge
Als Levine vor einem Jahr noch für die koschere Lebensmittelmarke Manischewitz arbeitete, produzierte er zeitgleich als Comedian Instagram-Videos, die sich mit jüdischen Sportlern beschäftigten. Immer wieder gibt es gerade in den USA Scherze darüber, dass es kaum jüdische Weltklasse-Athleten gäbe. Jake Retzlaff, der sehr erfolgreiche Football-Quarterback an der Brigham Young University, galt immer als Ausnahme. Levine vermittelte Retzlaff an Manischewitz, die schlossen den ersten Sportdeal ihrer Firmengeschichte ab, und eine Erfolgsgeschichte begann. Dass Retzlaff nämlich für Latkes Werbung machte, fiel auch anderen Collegesportlern auf, die ebenfalls vom NIL-Deal profitieren wollten und sich an Levine wandten. »Tribe NIL« war geboren.
Auf diese Weise erfuhren Levine und sein ins Boot geholter Kumpel Moses fast nebenbei und zu ihrer Verblüffung, wie viele jüdische Spitzensportler es eigentlich gibt. Mit rund 200 haben sie bisher Verträge abgeschlossen, und das ist erst der Anfang. Die Chance, das hartnäckige Stereotyp vom unsportlichen Juden zu widerlegen, ist also immer noch groß.