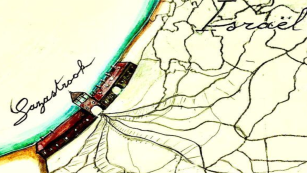Die ansonsten sehr auf Diskretion bedachte Pariser Polizei unternimmt einen wichtigen Schritt in Richtung Transparenz. Ab 2015 sollen die Namen tausender französischer Bürger, die in der Zeit der deutschen Besatzung (1940–44) mit den Nazis kollaboriert haben, im Internet veröffentlicht werden.
Nach Ablauf der gerichtlich angeordneten Schonzeit von 75 Jahren steht der Veröffentlichung der polizeilichen Dokumente nichts mehr im Weg. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sollen sämtliche Inhalte des über 200.000 Seiten umfassenden Archivs der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bis dahin kann das Archiv nur auf Anfrage von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Journalisten eingesehen werden. Privatpersonen müssen besondere, nachweisbare Gründe haben, um eine Genehmigung zu bekommen.
Staubige Kartons Der Historiker Jean-Marc Berlière war der Erste, dem 1994 Zutritt zu den Archiven gewährt wurde. Unzählige Stunden verbrachte er inmitten der staubigen Kartons, die sich im Kellergewölbe des Polizeipräsidiums kilometerweise stapeln. Berlière befürchtet, dass die Veröffentlichung der Polizeiprotokolle ohne Angaben zum Hintergrund der jeweiligen Person auch heute noch erheblichen Schaden verursachen kann. Denn wer den Kontext nicht kenne, interpretiere die Geschehnisse oft völlig falsch.
Berlière nennt ein Beispiel: »Da gab es den jungen Mann, der der Waffen-SS beitrat. Wenn man das in den Dokumenten liest, kommt man zu dem Schluss, dass er eben ein überzeugter Nazi war. Würde man genauere Nachforschungen anstellen, wie Berlière es als Historiker getan habe, dann erführe man, dass der junge Mann in Wirklichkeit von den Nazis erpresst wurde«, erzählt der Experte, »denn sein Vater war Gefangener in Deutschland und schwer krank. Um ihn nach Hause holen zu können, wurde dem Sohn nahegelegt, sich der Waffen-SS anzuschließen.«
Jüdische Kollaborateure Wie dieser Fall zeigt, geht aus den Protokollen nicht in jedem Fall hervor, ob sich jemand dem Nationalsozialismus tatsächlich verschrieben hatte oder nur vorgab, Teil des Systems zu sein, um sich und andere vor dem Tod zu bewahren. Noch komplexer wird es, wenn man die mit »Jüdische Kollaborateure« beschrifteten Kartons genauer unter die Lupe nimmt. »Es gab Juden, die andere Juden denunzierten, weil sie dachten, nur so ihre Familie retten zu können«, sagt Berlière. »Das sind furchtbare Schicksale, die man erst dann richtig verstehen kann, wenn man den Kontext im Detail kennt.«
Der Vorsitzende der französisch-jüdischen Dachorganisation CRIF, Richard Prasquier, hält Berlières Vorbehalte für unbegründet. »Das ist nicht wie etwa bei der Stasi. Natürlich kann die Veröffentlichung solcher Dokumente auch hier Schaden verursachen, aber in Frankreich sind die Regeln erstens strenger und zweitens werden ja wahrscheinlich nicht alle Dokumente veröffentlicht. Ich vertraue darauf, dass die Verantwortlichen bei der Polizei von Fall zu Fall die richtige Auswahl treffen.«
Prasquiers Ansicht nach sind die französische Regierung und insbesondere die Polizei seit einigen Jahren um Transparenz bemüht. »Als ich noch Präsident des französischen Yad-Vashem-Komitees war, beklagten sich viele, dass man nichts über die Arbeit der Polizei wisse, die ja während des Krieges eine wichtige Rolle spielte. Das hat sich inzwischen geändert.«
Aufarbeitung Arielle Schwab, Präsidentin der Vereinigung jüdischer Studenten in Frankreich (UEJF), sieht in der Veröffentlichung des Archivs einen weiteren Schritt in Richtung lückenloser Aufklärung. »Ich finde es ehrenwert, dass Frankreich mit der Aufarbeitung fortfährt und sowohl Wissenschaftlern als auch Privatpersonen die Möglichkeit gibt sich zu informieren und so die Ereignisse von damals besser zu verstehen.«
In der jüdischen Gemeinschaft ist das Thema, so Richard Prasquier, bislang nicht auf breiter Ebene diskutiert worden. Das dürfte damit zusammenhängen, dass das Pariser Polizeipräsidium vor fünf Jahren bereits ein Abkommen mit dem Memorial de la Shoah über den gegenseitigen Austausch der Archive aus der Besatzungszeit unterzeichnet hat. Wer sich also für die Dokumente interessiert, der hatte schon seit mehreren Jahren Gelegenheit, das Archiv einzusehen, wenn auch in beschränktem Maße.
Für die französische Polizei ist die digitale Erfassung der Protokolle vor allem von praktischem Nutzen. Dadurch können die bereits verfallenden Schriften auf lange Sicht erhalten werden.