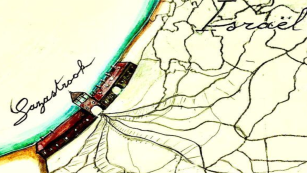Dass die jüdische Gemeinde in Peking etwas ganz Besonderes ist, ahnt man, sobald man mit der Polizei zu tun hat. Die wartet in Form zweier uniformierter Ordnungshüter am Schlagbaum einer geschlossenen Wohnanlage, in der sich der Gebetsraum von Chabad Lubawitsch befindet. Die orthodoxe Organisation trägt für einen wesentlichen Teil des spirituellen Lebens der Juden in Peking Verantwortung. Nach einer kurzen Diskussion mit den Polizisten und einem längeren Herumirren zwischen durchaus prächtigen Villen in italienischem Stil tritt man ein in das Haus von Rabbi Shimon Freundlich, in dem auch seine Gemeinde regelmäßig zusammenkommt.
Chabad Mit wenigen Schritten geht es vorbei an einem Ölgemälde des Chabad-Übervaters Menachem Mendel Schneerson (1902–1994), hinein in eine Art Wohnzimmer, das beides zugleich ist: Gebetsraum und Museum. Denn an den Wänden hängen Bilder früherer Synagogen in China, darunter Vitrinen mit alten Kultgegenständen und Objekte der jüdischen Geschichte im Reich der Mitte. Besonders eindrucksvoll: der Pass einer deutschen Jüdin, die, wie etwa auch der Leiter des Jüdischen Museums Berlin, W. Michael Blumenthal, Ende der 30er-Jahre vor den Nazis aus Deutschland nach Schanghai floh und später in die USA auswanderte. In gewisser Weise ist diese Geschichte auch noch heute typisch für die jüdische Gemeinde in Peking: Viele sind hier nur auf Durchreise. Richtige Wurzeln hat die Gemeinde noch nicht geschlagen.
Dabei hat das jüdische Leben in China durchaus eine eindrucksvolle Tradition. So kamen wohl spätestens im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Juden ins Reich der Mitte. Die jüdische Gemeinde in China blieb aber immer verhältnismäßig klein. Das gilt vor allem, nachdem Mao Zedong 1949 die Volksrepublik ausgerufen hatte – als einen atheistischen Staat wohlgemerkt, in dem zunächst alle Religionen verfolgt wurden, auch das Judentum. Die meisten chinesischen Juden flohen deshalb nach Israel oder in die USA.
Für das Judentum war die Lage besonders prekär, da in der Volksrepublik nur fünf Religionen offiziell anerkannt sind: Buddhismus, Daoismus, Islam, Katholizismus und Protestantismus. Alle anderen Religionen gelten offiziell als Aberglaube oder Häresie.
Das ist auch der Grund, weshalb der 37-jährige Rabbi Freundlich auch nach einem weinseligen Abend mit seinen Leuten sehr vorsichtig wird, wenn man ihn nach seiner Gemeinde – und seinem Verhältnis zur Staatsmacht befragt. Zunächst sagt der clevere Rabbi zwar, es sei nicht schwierig, hier in Peking eine Gemeinde zu führen. Tatsächlich wirken die Treffen der Gemeinde ziemlich gelassen. Vor allem Englisch und Hebräisch ist zu hören, international und weltoffen wirkt alles. Dann aber deutet Rabbi Freundlich an, dass die Behörden doch sehr genau beobachten, was da so unter dem Davidstern im Machtzentrum Chinas passiert. Das Judentum sei eben 1949 nicht in einer Position der Stärke gewesen, um als offizielle Religion anerkannt zu werden, deutet er an.
Deshalb darf sich Rabbi Freundlich, der seinem Namen alle Ehre macht, offiziell nur um die Juden kümmern, die einen ausländischen Pass haben. Das tut er seit dem Jahr 2001, als er von London nach Peking kam: »Ich dachte, ich muss kommen«, sagt er dazu. Seine Gemeinde hat seinen Aussagen zufolge etwa 2.000 Mitglieder, im Sommer kommen am Schabbat rund 150 zu den Gottesdiensten, im Winter sind es nach seiner Schätzung nur etwa die Hälfte. Immerhin, es gibt in der Gemeinde eine Schule, eine Mikwe und sogar ein koscheres Restaurant.
Liberal Neben Chabad gibt es in Peking noch die liberale Gemeinde Kehillat Beijing, die noch amerikanischer und familiärer wirkt als die orthodoxe Konkurrenz. Hier werden auch Frauen im Minjan akzeptiert. Kehillat Beijing ist seit 1979 in Peking aktiv. Die Gemeinde entstand 1979, als es aufgrund der Reformen unter Deng Xiaoping möglich wurde, als Juden wieder einigermaßen offen aufzutreten. Zunächst traf sich die Gemeinde in den Wohnungen und Häusern von vor allem nordamerikanischen Geschäftsleuten, Journalisten oder Diplomaten in Peking. Als diese Gemeinschaft im Laufe der 90er-Jahre durch Juden aus anderen Ländern immer größer und internationaler wurde, etablierte man sich 1995 offiziell. Seitdem gibt es jeden Freitagabend regelmäßige Gottesdienste – immer noch im dritten Stock des Capital Club Athletic Center von Peking.
Ein jüdischer Student aus Chicago, der anonym bleiben möchte, kennt beide Gemeinden ziemlich gut – und gibt in einer sündhaft teuren Bar nicht weit von der Chabad-Gemeinde tieferen Einblick in das Judentum in Peking. Der junge Kippa-Träger sieht das Aufblühen der Gemeinden in den vergangenen Jahren als ein Zeichen wachsenden Interesses der chinesischen Bevölkerung am Judentum. Ein Beispiel seien seine chinesischen Kommilitonen: Zwar hätten die meisten so gut wie keine Ahnung vom Judentum – ebenso wenig, wie sie vom Christentum wüssten.
Beide Religionen hätten in China ein modernes Image, meint der junge amerikanische Jude, da sie eben die Hauptglaubensrichtungen des teilweise immer noch bewunderten Westens seien. Gerade das antisemitische Vorurteil, dass Juden gut mit Geld umgehen könnten, sei für viele in der durch und durch materialistischen Gesellschaft Chinas ein Grund, sich mit dem Judentum zu beschäftigen. Sie wollten den »jüdischen Trick« herausfinden, wie man zu Geld komme, sagt der junge Chicagoer.
In einem pressefeindlichen Regime, das freie Religionsausübung wie etwa in der katholischen Untergrundkirche meist immer noch verfolgt, ist die Recherche auch über die jüdische Gemeinde schwierig. Wenige Leute reden offen, und wenn, wollen sie vieles nicht in der Zeitung lesen. Man müsse schon so gut mit Worten umgehen können wie ein Rabbiner, um beim Kontakt mit der Staatsmacht nicht ins Hintertreffen zu geraten, sagt Rabbi Freundlich am Ende des Gesprächs, ehe er sich wieder um seine Familie kümmern muss. »Sie akzeptieren uns, solange wir da sind – und nicht da sind«, sagt er. Die Polizisten am Schlagbaum lächeln freundlich zum Abschied.
www.chabadbeijing.com
www.sinogogue.org