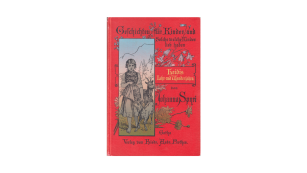Frau della Valle, wie wird die Terrorgefahr für die Schweiz aktuell eingestuft?
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) schätzt die Terrorlage in der Schweiz derzeit als erhöht ein. Nach den Bataclan-Anschlägen in Paris vor fast zehn Jahren hat man auch in der Schweiz realisiert, dass sich der islamistische Terrorismus vor der Haustür abspielt. Seither ist klar, dass die Polizei noch mehr zusammenarbeiten muss.
Wie geht das fedpol dagegen vor?
Die Terrorismusbekämpfung erfordert eine enge Vernetzung von nachrichtendienstlichen, präventivpolizeilichen und repressiven Instrumenten sowie sozialpolitischen Massnahmen zur Prävention von Radikalisierung. In enger Zusammenarbeit mit den Bundes- und Kantonsbehörden koordiniert fedpol seit 2015 die operationelle Plattform TETRA (Terrorist Tracking), die den effizienten Austausch in Terrorismusfällen gewährleistet. Die 2022 eingeführten polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) ermöglichen eine gezielte Kontrolle gefährdeter Personen zum Beispiel durch Gesprächsauflagen oder Kontaktverbote. Ergänzende präventive Massnahmen sind Einreiseverbote und Ausweisungen wegen Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz. fedpol unterstützt zusätzlich lokale Initiativen von Kantonen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft finanziell als Teil des Aktionsplans gegen Radikalisierung.
Diese so genannten Low-Cost-Angriffe sind nicht verhinderbar.
Wo liegen die Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland? Geht die Schweiz anders vor bei der Terrorbekämpfung?
Wie die Schweiz ist auch Deutschland ein föderalistisches Land mit einer föderal organisierten Polizei, was die nationale Zusammenarbeit unerlässlich macht. Beide Länder müssen mit dieser Besonderheit umgehen. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie Deutschland, beispielsweise in Bezug auf die Radikalisierung von Minderjährigen, insbesondere der Online-Radikalisierung. Außerdem beobachten wir häufig grenzüberschreitende Verbindungen zwischen radikalisierten Einzelpersonen und Gruppen, sei es zwischen der Schweiz und Deutschland oder auch mit Österreich. Kooperation und Koordination sind daher nicht nur innerhalb unserer Länder, sondern auch zwischen ihnen von größter Bedeutung. Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und basiert auf einer gemeinsamen Vision und auf gegenseitigem Vertrauen mit unseren deutschsprachigen Nachbarn.
Der islamistisch motivierte Angriff auf einen orthodoxen Juden am 2. März 2024 jährt sich demnächst. Wäre er verhinderbar gewesen?
Diese so genannten Low-Cost-Angriffe sind nicht verhinderbar. Wir können weder alles voraussehen, noch können wir alle extremistisch denkenden Menschen wegsperren. Wir leben zum Glück in einem Rechtsstaat, dessen Schutz zu unseren Aufgaben gehört. Das Beunruhigende an der Sache ist allerdings: Solche Angriffe können jederzeit wieder geschehen. Nicht nur auf jüdische Mitbürger. Sie können jede und jeden treffen.
Welche Lehren zieht fedpol aus diesem Angriff?
Dass die Attentäter immer jünger werden. Sie radikalisieren sich im Verborgenen über die sozialen Medien. Diese Entwicklung beobachten wir seit Längerem. Daher ist nicht nur die Polizei, sondern die ganze Gesellschaft gefordert, dagegen anzukämpfen. Neben der Polizei- müssen wir noch vermehrt auf Präventionsarbeit setzen. Hier sind Schulsozialarbeitende, Lehrbetriebe, Sportvereine, Moscheen aber auch Private gefordert, Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Jugendlichen müssen den Umgang mit sozialen Medien lernen. Denn es ist klar, dass etwas schiefläuft, wenn ein 15-Jähriger mit einem Messer auf die Straße geht und auf Menschen einsticht.
Wie steht es um die Sicherheit jüdischer Menschen in der Schweiz?
Seit dem 7. Oktober 2023 nahm der Antisemitismus massiv zu bzw. wurde klar, dass der bis anhin in der Schweiz eher latente Antisemitismus viel deutlichere Formen angenommen hat. Das beunruhigt mich. Er wurde salonfähig, kommt an Schulen und Universitäten immer deutlicher zum Ausdruck. Die Gesellschaft fühlt sich mehr und mehr legitimiert, sich antisemitisch zu äußern. Das ist besorgniserregend.
Antisemitismus wurde salonfähig, kommt an Schulen und Universitäten immer deutlicher zum Ausdruck. Das ist besorgniserregend.
Was unternimmt der Bund dagegen?
Der Bund investiert viele Mittel, um jüdische Institutionen, baulich genauso wie organisatorisch, zu schützen. Auch gewisse muslimische Institutionen erhalten nun Schutz. Die Kantone sorgen auch für verstärkte Polizeipräsenz vor den jüdischen Institutionen. Bei der Gefahrenanalyse arbeiten Polizei und Nachrichtendienst eng zusammen.
Das Hamas-Verbot wurde von Regierung Parlament angenommen und tritt bald in Kraft. Was bedeutet das für die Schweiz? Wieso ist dieses Verbot aus Sicht der Sicherheitsorgane dermaßen wichtig?
Es geht in erster Linie darum, festzustellen, ob die Hamas finanzielle Beziehungen zur Schweiz pflegt, anschließend diese Finanzflüsse zu unterbinden. Mit dem Verbot wird Rechtssicherheit für die Finanzintermediäre geschaffen. Ein Verbot erleichtert aber auch das repressive Vorgehen. In einem Strafverfahren gegen mutmaßliche Hamas-Unterstützer muss die Strafverfolgungsbehörde nicht mehr den Nachweis erbringen, dass es sich bei der Hamas um eine terroristische Organisation handelt. Das gleiche gilt auch im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht bei präventivpolizeilichen Maßnahmen. Zudem ist die Hamas in den Nachbarsländern der Schweiz bereits als Terrororganisation gelistet. Mit dem Verbot verhindert die Schweiz zu einer Insel der Glückseligen werden und als Rückzugsort oder Finanzdrehscheibe attraktiv zu sein. Während der Wintersession hat das Parlament dem Bundesrat den Auftrag erteilt, auch für den Hisbollah ein Verbot zu erarbeiten.
Das Gespräch mit fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle führte Nicole Dreyfus.