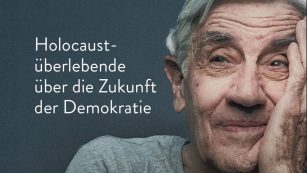Wenn am 5. November im Berliner Centrum Judaicum der dreitägige Jüdische Zukunftskongress eröffnet wird, werden junge Juden nicht nur Vorträge hören, sondern auch ganz konkret über ihre Träume, Hoffnungen und Ängste diskutieren.
»Eine gesamtgesellschaftliche und bildungspolitische Perspektive aus der jüdischen Erinnerung« lautet zum Beispiel der Titel einer Diskussion am 8. November. Eine der Teilnehmerinnen wird die Kulturwissenschaftlerin Olga Osadtschy sein.
Die Frage nach der Zukunft laufe im Grunde auf ein Thema hinaus, sagt die 33-Jährige: »Wie möchte man zusammen leben? Und genau diese Frage stellt man sich doch in jedem Land und in jedem Kulturkreis – auch wenn man manchmal glauben könnte, dass sich nicht so viele Menschen wirklich ernsthaft damit befassen.«
Verständlich sei das einerseits schon, denn »das ist ja durchaus ein riesiges und kompliziertes Thema, aber eigentlich geht es doch um das Einzige, was zählt: Man wünscht sich, dass man selbst und die Kinder in einer Welt ohne Krieg und Leid leben.« Olga Osadtschy ist in der Ukraine aufgewachsen und kam als Kind gemeinsam mit ihren Eltern nach Potsdam, wo sie das Abitur machte. »Und nun ist in meinem Geburtsland, also mitten in Europa, wieder Krieg. Man sieht, das kann schneller gehen, als man denkt.«
Teilhabe Durch das Internet sei die Teilhabe an Debatten über lokale wie globale Zukunftsfragen viel einfacher geworden, sagt sie. In den digitalen Dialogen werde allerdings »bedauerlicherweise schnell vergessen, dass Konflikte auch bereichern.« Daher sei auch das Thema Diskussionskultur wichtig. Andere Meinungen anzuhören und »die Pluralität der Stimmen zuzulassen, Vielfalt nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern als Gewinn«, gehöre unbedingt dazu.
»Dass der Ton in öffentlichen Debatten häufig nicht von gegenseitigem Respekt getragen wird, sondern man den Eindruck hat, je polemischer jemand wird, desto eher wird er gehört, ist durchaus ein Problem. Wir brauchen allgemein mehr Bereitschaft, dem anderen zuzuhören.«
Osadtschy lebt mittlerweile in der Schweiz, wo sie als Assistenzkuratorin im Kunstmuseum Basel arbeitet. Natürlich beschäftige man sich in dem kleinen Land, das von außen gern als sicheres Idyll angesehen wird, mit den gleichen Fragen und Problemen wie anderswo. »Gerade in den vergangenen Monaten hat man doch gemerkt, dass in diese relative Zufriedenheit immer wieder Dinge reinknallen, die man nicht ignorieren kann«, sagt sie.
»Man kann sich nicht mehr so einfach biedermeierlich in sein Privatleben flüchten und so tun, als gehe das, was draußen in der Welt passiert, einen nichts an.« Im Freundes- und Bekanntenkreis gebe es daher »immer mehr Menschen verschiedenen Alters, also nicht nur junge, die sich auf ganz unterschiedliche Weise engagieren, von Teilnahmen an Demos bis hin zur Mitarbeit im Elternbeirat, um dabei zu helfen, Kinder für das Thema Flüchtlinge zu sensibilisieren«.
Mit persönlichem Engagement den Grundstein für eine gute Zukunft zu legen, ist für Olga Osadtschy wichtig. »Man darf sich einfach nicht komplett zurückziehen«, hat sie deshalb auch für sich beschlossen, »ich engagiere mich beispielsweise in einem Mehrgenerationen-Projekt, das finde ich auch für meine kleine Tochter gut.«
Außerdem ist sie in der Flüchtlingsarbeit aktiv: »Ich kann mich noch gut daran erinnern, was das für eine große Herausforderung war, als wir in das fremde Deutschland kamen und zum Beispiel die Sprache noch nicht gut konnten. Wir haben damals sehr viel Unterstützung erhalten, und nun kann ich etwas davon zurückgeben.«
Flüchtlinge Osadtschy hilft Flüchtlingen bei »praktischen Herausforderungen, also Bewerbungsunterlagen erstellen, die Sprache zu lernen«. Dass sie Jüdin ist, verschweigt sie dabei nicht, »und ich habe noch nie eine negative oder irritierte Reaktion erlebt, im Gegenteil, die Leute sind dann eher sehr neugierig und möchten mehr über das Judentum erfahren, und daraus ergibt sich dann ein reger Austausch«.
Die Judaistin Cecilia Haendler wird beim Zukunftskongress an einer Podiumsdiskussion zum Thema »Denominationen. Gelebter Pluralismus im Judentum« teilnehmen. Die gebürtige Italienerin und ihr israelischer Mann zogen nach der Hochzeit in Jerusalem nach Berlin. »Für uns bot sich dort die Möglichkeit, an diesem neuen Ort unsere Welt zu schaffen – die Stadt hatte und hat auch noch heute diese unglaubliche Kraft, enorme Möglichkeiten und riesige Energie. Alles ist offen, man kann seine Zukunft gestalten und das eigene Judentum aufbauen.«
Natürlich seien die Eltern und Schwiegereltern nicht begeistert gewesen, dass es das junge Paar ausgerechnet nach Deutschland zog, »aber für uns ist Berlin heute ein anderer Ort als damals zur Nazizeit. Und Veränderung, auch von Orten, ist eben auch ein Aspekt von Zukunft«. Seit einem Jahr wohnen die Haendlers nun aber in Paris, »jobhalber«, sagt die 30-Jährige. »Die jüdische Gemeinschaft ist dort viel größer als in Berlin, und sie ist auch viel religiöser, was dazu führt, dass die jüdische Infrastruktur sehr gut ist.« Gleichzeitig biete das für junge Leute weniger Möglichkeiten, ihr eigenes Judentum zu entdecken und zu entwickeln, was Cecilia Haendler bedauerlich findet.
In welchem Land ihre Zukunft liegen wird, weiß sie noch nicht. »Nach Italien möchte ich nicht zurück, die jüdische Gemeinschaft ist dort nicht groß, die Jungen sind nach Israel gezogen, und nur die Alten sind noch da, dort etwas aufzubauen, ist sehr schwierig.«
Rechtspopulisten Das Erstarken der Rechten in Europa sieht sie sehr kritisch. »Aber das ist ein globales Problem, in Israel und in den USA ist es ja ähnlich«, sagt Haendler. Man könne schon sagen, dass es derzeit einen Trend zu Nationalismus gibt, »aber ob er anhält, das ist schwierig zu sagen, ich weiß es nicht, ich finde es auch zunehmend schwieriger, die Politik zu lesen«.
Wie viele junge Menschen sagt auch Haendler, dass sie eigentlich in einer »Filterblase lebt, der Freundeskreis ist sehr offen, politisch liberal und tolerant, ich lebe, so gesehen, in meiner kleinen Welt«. Sie bekomme aber durchaus mit, was in der großen Welt vorgeht. »Ich bin oft dankbar, dass ich als religiöse Person an Schabbat abschalten kann, ich sehe das auch als eine wohltuende Medizin gegen den allgemeinen Trend unter anderem des dauernd Erreichbar-Seins, mal einen kleinen Schritt zurückzugehen.«
Religion Religion könnte ein wichtiges Zukunftsthema sein, findet Haendler. »In der Generation meiner Eltern und Schwiegereltern hat sie keine große Rolle gespielt, aber Religion als Identität, als Ort, an dem man sich sicher fühlen kann, das wird meiner Meinung nach wieder zunehmend wichtig werden.« Gerade auch für junge Juden, »das Judentum ist schließlich auch eine praktische Religion, mit Betonung auf Werten wie Gemeinschaft und Verantwortung«. Und ohne hierarchische Struktur, die unterschiedliche Sichtweisen nicht zulassen, »da kann das Judentum anderen Religionen in ihrer zukünftigen Entwicklung vielleicht auch ein Beispiel sein«.
Denn zum Judentum gehöre beispielsweise Respekt für Diversität. »Juden haben schließlich immer mit der Idee gelebt, dass nicht alle Menschen jüdisch sein müssen, sondern dass auch jeder Nichtjude Teil der zukünftigen Welt sein kann, wenn er oder sie eine gerechte Person ist.«
Und so ist auch ein weiteres Thema, von dem Haendler annimmt, dass es wichtig werden dürfte, eines, das mit Religion zu tun hat: In Europa könnte zukünftig auch Solidarität unter Juden und Muslimen »mehr Bedeutung bekommen. Wir begegnen schließlich oft den gleichen Problemen, die wir gemeinsam viel besser lösen oder bewältigen können.« Juden und Muslime seien schließlich religiöse Minderheiten, die ihre Rechte »in Allianzen viel besser verteidigen können – das hat sich ja auch schon bei einigen konkreten Fragen wie zum Beispiel der Beschneidung gezeigt.«