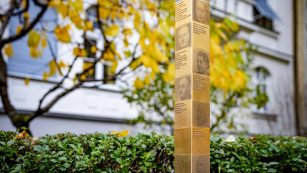Im Zuge der Corona-Pandemie und der jüngsten Krise in Nahost häufen sich in Deutschland antisemitische Vorfälle. Auch in München ist die jüdische Gemeinschaft angesichts der Ausschreitungen bei israelfeindlichen Kundgebungen in den vergangenen Tagen und Wochen beunruhigt.
Frau Knobloch, brennende Israelfahnen, Angriffe auf Synagogen und Juden – es gibt so viele antisemitisch motivierte Straftaten wie noch nie. Überrascht Sie das?
Ich bin besorgt über die Entwicklung der letzten Jahre, ich nehme die Sorgen und Ängste in der Gemeinde wahr, aber überrascht bin ich nicht. Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet. Was mich aber dabei zutiefst erschüttert, ist der Umstand, wie schamlos und offen der Antisemitismus inzwischen transportiert wird. Die Bilder von den gerade zurückliegenden Demonstrationen sind ein Beispiel von vielen. Oft sind es auch nur vermeintliche Kleinigkeiten, die man wahrnimmt.
Wie sieht so eine »Kleinigkeit« beispielsweise aus?
Ich muss nur an die vielen Zuschriften denken, die bei der Israelitischen Kultusgemeinde ankommen. Hassbotschaften, Antisemitismus in übelster Form, persönliche Angriffe, Drohungen – das ganze erdenkliche Spektrum hat die Gemeinde schon immer erreicht. Natürlich hat sich die Zahl dieser Pamphlete durch das Internet vervielfacht. Aber auffallend ist, dass viele dieser Briefe inzwischen einen richtigen Absender tragen. Bis vor wenigen Jahren kamen die allermeisten anonym.
Die Landtagsfraktionen von CSU, Freien Wählern, Grünen, SPD und FDP haben gerade eine gemeinsame Resolution gegen Antisemitismus und Rassismus verabschiedet …
… und damit einen demokratischen Aufschrei getan, der nicht dringlicher hätte sein können. Viele Juden verlieren derzeit das Grundvertrauen in Mitmenschen und Gesellschaft, ihr Alltag ist geprägt von Angst und Unsicherheit. Wer den Fehler begeht, als jüdischer Mensch sichtbar in den sozialen Medien aktiv zu sein, dem ist klar, was ich meine. Und genau hier ist auch die Politik gefordert. Es geht nicht um Lippenbekenntnisse, sondern um konsequentes Handeln.
Was verstehen Sie darunter?
Wenn Rechtsextreme und muslimische Verbände Israel- und Judenhass befeuern und zugleich jüdische Menschen das Gefühl haben, mit ihrer Angst alleingelassen zu werden, dann werden Grenzen überschritten, die politisches Handeln notwendig machen. Eine Politik, die hier untätig bleibt, verliert sonst ihre Daseinsberechtigung.
Einfluss auf das stärker werdende antisemitische Grundrauschen in der Gesellschaft wird nach Erkenntnissen der Behörden den Corona-Leugnern zugemessen. Befördert diese Szene Ihrer Meinung nach Antisemitismus und extremistische Tendenzen?
Ich will nur daran erinnern, dass Hass und insbesondere Antisemitismus schon einmal entscheidende Faktoren waren, um die Demokratie zu Fall zu bringen. Diese Faktoren haben nach wie vor ein nicht zu unterschätzendes Potenzial und spielen auch in der Corona-Leugner-Szene eine entscheidende Rolle. Die Performance dieser Szene zeigt auch, wie schnell Teile der Gesellschaft abdriften und in extremistische Denkmuster verfallen können. Ähnliches gab es schon einmal.
Jüdische Repräsentanten werden hin und wieder dafür kritisiert, die Erinnerungskultur zu übertreiben. Sind hier Grenzen erreicht?
Gegner einer Impfung, die sich selbst gelbe Sterne anheften, und Demonstranten, die Gesetzesvorhaben zum Infektionsschutz mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten vergleichen, unterstreichen nur, wie absurd der Vorwurf einer angeblich übertriebenen Erinnerungskultur ist. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt, wo die letzten Zeitzeugen von uns gehen, brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Gedenken. Wissen um die Vergangenheit, kombiniert mit einem tatkräftigen Erinnern, ist keine inhaltslose Floskel, sondern ein Gegengewicht zu Extremismus und Geschichtsvergessenheit – und das Mittel zum Zweck, Werte wie Freiheit, Toleranz und Respekt auf Dauer zu erhalten. Wir brauchen das auch, um »moderne« Formen von Antisemitismus zu erkennen.
Sie meinen mit »modern« zum Beispiel den sich als sogenannte Israelkritik tarnenden Antisemitismus?
Jüdinnen und Juden leben heute in einer Gesellschaft, in der Filterblasen unterschiedlichster Couleur den Antisemitismus in Wort und Tat weiter befeuern. Dazu zählt auch, wenn sich prominente Persönlichkeiten wie die Klima-Aktivistin Greta Thunberg mit Un- oder Halbwissen in die Debatte einschalten und auf ihrem Twitter-Account die Aussagen einer bekannten Befürworterin der antisemitischen BDS-Bewegung verbreiten.
Warum erstarkt Antisemitismus gerade jetzt wieder?
Antisemitismus hat es immer gegeben, er war nie ganz verschwunden. In den 70er-Jahren, nach dem mörderischen Brandanschlag auf das jüdische Seniorenheim und nach dem Olympia-Attentat in München, war Judenfeindlichkeit zumindest in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent und salonfähig. Aber das war nur eine schnell vorübergehende Zeiterscheinung.
Sie sind ein »Münchner Kindl«, haben aber kein Geheimnis daraus gemacht, dass Sie nach der NS-Zeit Deutschland am liebsten verlassen wollten. Empfinden Sie München als Ihre Heimat?
Inzwischen ohne Einschränkungen, aber ich saß mehr als die Hälfte meines Lebens gedanklich mit gepackten Koffern da. Die Synagoge und das Gemeindezentrum, die sichtbare Rückkehr des Judentums in das Herz der Stadt, waren entscheidend für die endgültige Beendigung des Traumas. Das ist noch nicht so lange her.
Mit der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern sprach Helmut Reister.