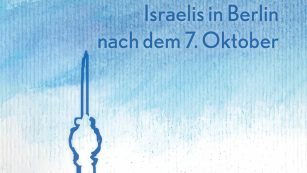Anmerkung der Redaktion (2. August 2023):
Als dieser Text von Fabian Wolff in der Jüdischen Allgemeinen erschien, glaubte die Redaktion Wolffs Auskunft, er sei Jude. Inzwischen hat sich Wolffs Behauptung als unwahr herausgestellt.
Die ersten Sekunden lassen Furchtbares erahnen: Klezmer! Die ARD-Dokumentation Auf das Leben! möchte einen frischen Blick darauf werfen, wie es sich anfühlt, »jüdisch in Deutschland« zu sein und tritt schon am Anfang in die schlimmste Klischeefalle.
Dabei macht die Reportage einiges richtig. Statt sich den allseits bekannten Gemeinden in Berlin und München zu widmen, haben sich die Macher Hannover ausgesucht – keine Stadt, bei deren Erwähnung man sofort an vibrierendes jüdisches Leben denkt. Dabei war die Hannoveraner Gemeinde vor 1933 eine vitale.
Heute verteilen sich auf die vier Gemeinden der Stadt rund 6.200 Mitglieder – davon 650 in der nach einer Spaltung gegründeten Liberalen Gemeinde und 400 bei Chabad Lubawitsch, 4.500 der Zentralratsgemeinde und etwa 220 in der jüdisch-sefardisch-bucharischen. Die Meisten sind Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion – eine ganz normale jüdische Gemeinde in Deutschland also, und eine kluge Wahl für eine Reportage.
Hochzeit Dramaturgischer Angelpunkt des Films ist die liberale Familie Seidler – Katharina, Johannes und ihre erwachsene Tochter Rebecca, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet. Sie hat den ersten liberalen jüdischen Kindergarten Deutschlands ins Leben gerufen, ihre Mutter gehörte zu den 79 »abtrünnigen« Juden, die 1995 die liberale Gemeinde gründeten.
Wenn jeder Jude in Deutschland so aktiv das Gemeindeleben mitbestimmen würde wie die Seidlers, müsste die Gemeinschaft nicht um ihr Fortbestehen bangen. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht sonderlich aufregend für eine Reportage, Juden zu zeigen, die am Freitagabend auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Und wahrscheinlich wäre es für Zuschauer dann doch sehr schwer zu verstehen, inwiefern jüdisches Leben außerhalb jeder religiösen Institution möglich sein soll.
Trotz zunehmenden Interesses der nichtjüdischen Öffentlichkeit, ist es genauso wenig möglich, im Jahr 2012 eine Reportage über Juden zu zeigen, in der nicht erklärt werden muss, was »koscher« bedeutet. Dafür darf Katharina Seidler später aber auch über die absurdesten Fragen berichten, die ihr von Nichtjuden schon gestellt wurden: ob die Mazze zu Pessach denn »immer noch« mit Christenblut gebacken wird, oder was sie von Mischehen zwischen Juden und »Ariern« halte.
Musik Ein weiterer Protagonist des Filmes ist der Musikprofessor Andor Izsák, der jüdische Synagogenmusik studiert und dafür in Hannover das Europäische Zentrum für Jüdische Musik aufbaut. Izsák sagt, dass er mit dem Kopf zwar dem liberalen Judentum verpflichtet, mit dem Herzen aber Teil der Tradition sein möchte.
Denn eigentlich geht es in der Reportage, allem Gerede um die Außergewöhnlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland zum Trotz, um die alte und allgemeine Frage: liberal, konservativ oder orthodox? Diesen Konflikten widmet sich der Film mit einer bemerkenswerten Offenheit und präsentiert dabei ein paar Momente, die dann doch überraschen: Wie etwa Katharina Seidlers Äußerung, dass es sehr viel schwieriger ist, eine liberale Jüdin zu sein.
Politik Die Konflikte, die zur Spaltung der Hannoveraner Gemeinde geführt haben, werden nur angedeutet – tiefe Einblicke in Gemeindepolitik darf man von dieser Dokumentation nicht erwarten. Dafür muss sich auch niemand sorgen, dass hier in der Öffentlichkeit unangebracht schmutzige Wäsche gewachsen wird.
Dass mit den Seidlers ausgerechnet eine von den »deutsch-jüdischen Familien« gezeigt wird, die schon vor dem Krieg im Lande gelebt hatte, geflohen war und die dann zurückkam, ist insofern fragwürdig, als dass die Probleme der die Mehrheit bildenden russischsprachigen Juden in Deutschland kaum angesprochen werden, von Stichworten wie »fehlende Religion« und »Sprachschwierigkeiten« abgesehen.
Als Gegenstück zur Familie Seidler wird im Film die Familie von Rabbiner Benjamin Wolff vorgestellt, der aus Israel nach Deutschland kam, mit dem expliziten Wunsch und Auftrag, in Hannover die Gemeinde aufzubauen. Feiern die Seidlers in ihrem Garten in Sommerkleidung den Schabbes, begehen die Wolffs ihn traditionell. Benjamin Wolff gehört zu Chabad Lubawitsch und leitet das Lernzentrum in Hannover. Und was das genau bedeutet, ist dann doch ein zu großes Thema für die Reportage. So steht eine recht kurze Szene, in der Wolff ein Gebetbuch studiert, während seine Frau den Fußboden schrubbt, ziemlich im luftleeren, weil unerklärten Raum.
Auch beim Thema Schoa verhebt sich der Film etwas – wenn der Überlebende Salomon Finkelstein von seinen Erinnerungen an Mengele erzählt, ist das bedrückend, erdrückt aber auch viel vom Rest der Reportage. Subtiler ist hingegen ein Satz von Rebecca Seidler darüber, dass es bei jüdischen Familien in Deutschland eben nicht viele Verwandte gebe.
Publikum Trotz des Titels und gelegentlicher klischeehafter Klezmeruntermalung hat man schon schlechtere Dokumentationen als Auf das Leben! gesehen – aber eben auch sehr viel bessere, wie Jew.de.ru oder Oma & Bella, die in diesem Jahr beim Jewish Film Festival und der Berlinale liefen. Doch richtet sich Auf das Leben! eben auch nicht wirklich an Juden, sonst würde der Film ja nicht um 17.55 Uhr an einem Samstag, am Schabbat, gezeigt. Daneben strahlt 3sat am 30. Juni (21.55 Uhr) noch eine 90-Minuten-Fassung aus, die ohne Off-Stimme auskommt und die Subtilität hat, die man beim Einstünder vermisst.
Dass die Reportage trotzdem sehenswert ist, liegt an den Porträtierten, die interessante Sachen sagen. Der Film selbst trägt nicht viel bei – bis auf die irritierende Häufigkeit von Profilaufnahmen. Auf das Leben! möchte wohl ein Film über jüdische Köpfe und Herzen sein, das ist ihm nicht ganz gelungen.