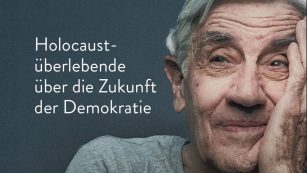Bis die Sanierung des Münchner Stadtmuseums volle Fahrt aufnimmt, hat Daniel Gitbud das ehemalige Stadtcafé am Jakobsplatz übernommen. Er ist ein Aktivist im besten Sinne – mit originellen Ideen wie der Schabbattafel am Marienplatz zum Gedenken an die nach Gaza entführten Menschen aus Israel und seinem mobilen Kaffeeausschank mit Gesprächsmöglichkeit unter dem Motto »Coffee with a Jew«. Nun heißt das Café »Nash« und soll auch der Kultur ein Zuhause bieten.
Als erfolgreichen Auftakt luden das Nash und das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern zu einer gemeinsamen Buchpräsentation ein. Mihail Groys stellte sein Buch Meine deutsche Geschichte im Gespräch mit Ariella Chmiel vor. 1991 im Donbass, »dem ukrainischen Ruhrgebiet«, geboren, wurde Groys im Alter von sieben Jahren nach Deutschland verpflanzt.
Mangels Deutschkenntnissen konnte der Vater nicht an seine erfolgreiche Karriere als Betriebsleiter anschließen. Für den Sohn wurde die Einschätzung, er würde nicht einmal die Mittlere Reife schaffen, ein Motivationsschub, es der Welt zu zeigen. Er studierte, arbeitete in der Musikindustrie sowie im Parlament und ist heute als politischer Referent und Publizist tätig.
Die Schilderung seines Werdegangs sollte nicht in Form einer Autobiografie erfolgen, sondern vielmehr zeigen, »wie ich als ukrainischer Jude meine neue Heimat sehe«. Anfangs erschien ihm der Donbass als dunkel, Deutschland als bunt. Funktionierende Heizung, Mülltrennung und Supermärkte mit Kühlregalen gehörten zum neuen Erfahrungshorizont, ebenso wie die Kühle und Distanziertheit der Menschen in Deutschland.
Ariella Chmiel befragte Groys nach seinen Ratschlägen für Eingewanderte.
Ariella Chmiel befragte Groys nach seinen Ratschlägen für Eingewanderte, konkret auch dazu, wie die Integration verlief und was die deutsche Seele ausmache. Zum erfolgreichen Ankommen gehöre der Spracherwerb, so Groys, um von den Bildungsangeboten und den Fördermöglichkeiten durch ein Stipendium profitieren zu können.
Während für sein deutsches Gegenüber die Ukraine weit weg im Osten war, interessierte sich Groys für seine neue Heimat, war sich bald bewusst, dass Juden Ureinwohner in diesen Landen waren – lange vor dem Siegeszug des Christentums. Die Familie habe einen sehr unterschiedlichen Stellenwert, im nichtjüdischen Umfeld wolle man die Kinder möglichst bald in die Welt entlassen, im jüdischen so lange wie möglich bei sich behalten.
Groys empfindet sich inzwischen als sehr deutsch, engagiert sich bei der SPD, fühlt sich als jüdischer Mensch mit Migrationshintergrund und einer erfolgreichen Identitätsgeschichte fähig zu einem Innen- und Außenblick. Er hadert mit der selektiven Wahrnehmung, wenn man sich mit Bach, Goethe, Luther und Wagner schmücken, den Holocaust aber vergessen will. Mit Chmiel ist er sich einig, dass der Umgang mit den Juden ein Indikator für den Zustand der Demokratie sei. Die Auswüchse einer globalen Intifada seit dem 7. Oktober 2023 empfindet Groys, gerade in Deutschland, als sehr erschreckend.
Mihail Groys: »Meine deutsche Geschichte. Wie ich als ukrainischer Jude meine neue Heimat sehe«. Edel Verlagsgruppe, Hamburg/München 2025, 174 S., 22,99 €