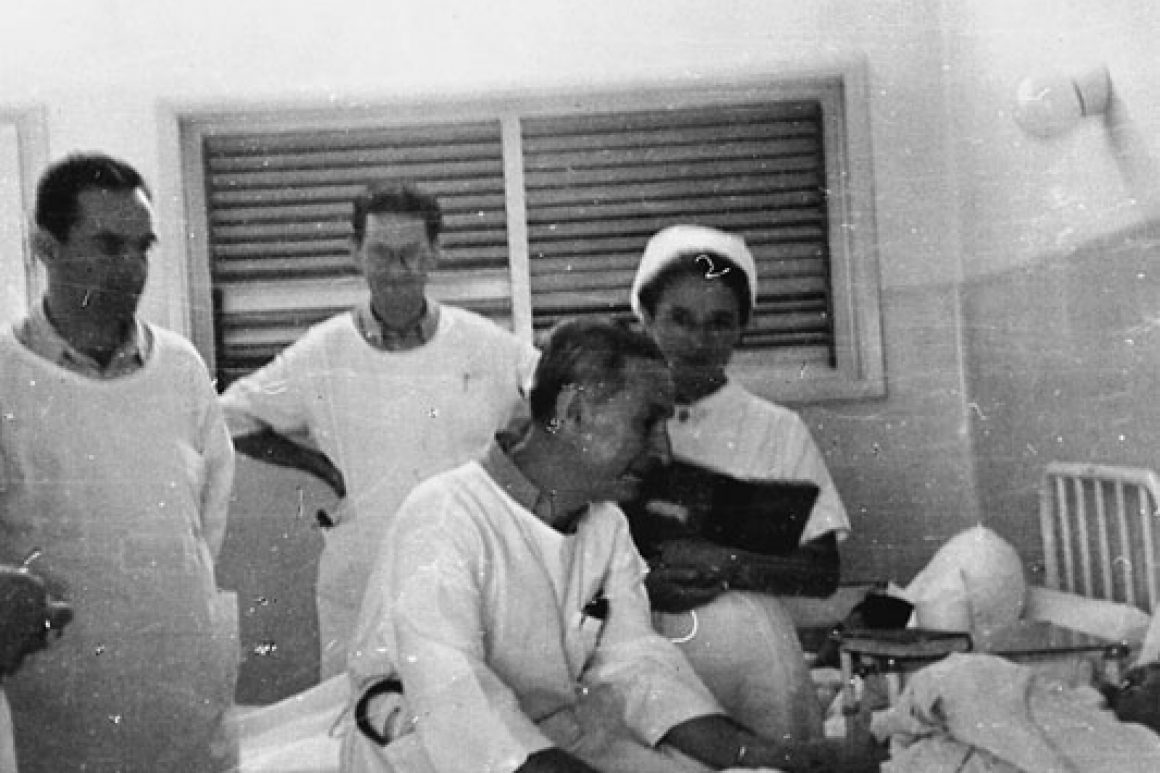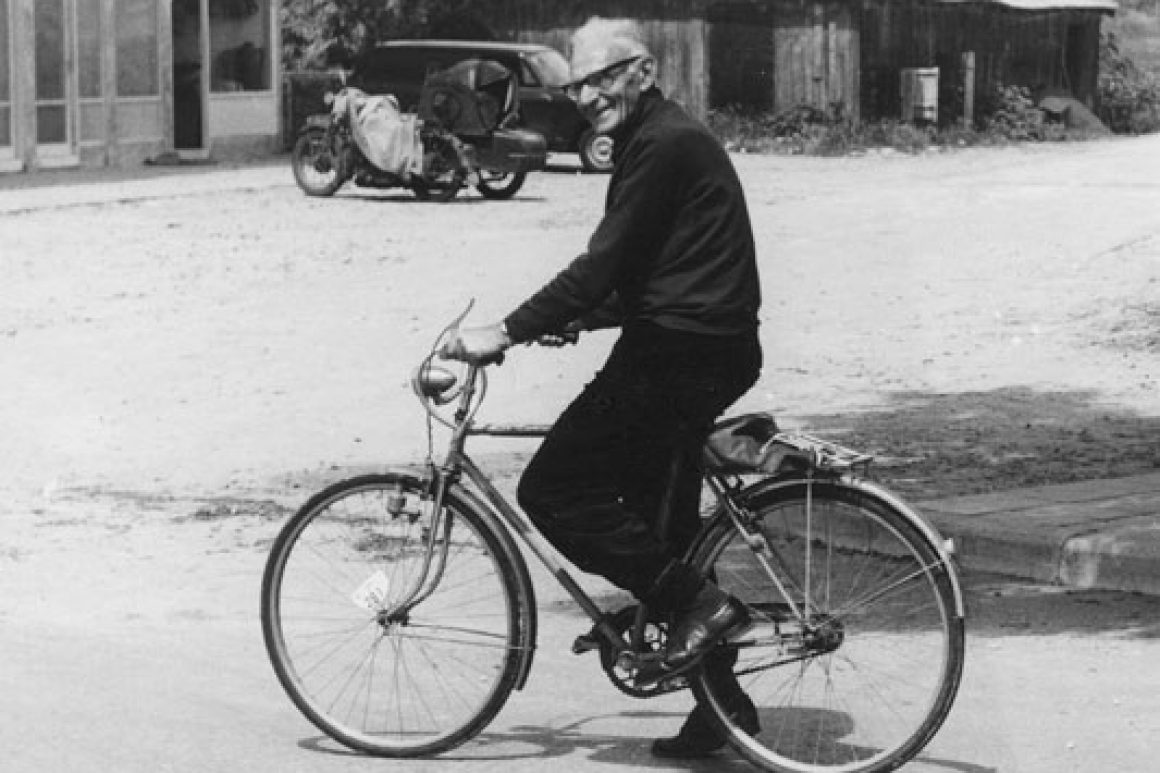Lazarus Eisemann war Allgemeinmediziner, Hans Ignaz Bernkopf frisch gebackener Virologe, als sie beide in den 30er-Jahren nach Palästina kamen. Ihre Lebensgeschichten sind im Internetlexikon Jüdische Ärzte aus Deutschland und ihr Anteil am Aufbau des israelischen Gesundheitswesens erfasst.
Die Ärzte kamen aus allen medizinischen Fachgebieten von Allgemeinmedizin über Gynäkologie, Neurologie bis Urologie und Virologie. Sie retteten sich aus Bayern, Ostpreußen, Schlesien oder Westdeutschland nach Palästina, um beim Aufbau eines Landes zu helfen, von dem sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen konnten, dass es mal ein eigener Staat werden sollte.
Nur eines hatten sie – manche allerdings erst in letzter Minute – begriffen: Sie mussten weg aus Nazi-Deutschland. Hans Ignaz Bernkopf ging 1934 nach Palästina, nachdem er Deutschland 1933 verlassen und sein Studium ein Jahr später in Basel abgeschlossen hatte. Seine Schwester Lotte folgte einige Jahre später. Vater und Mutter Bernkopf hielten es noch bis Anfang 1939 in Nürnberg aus. »Obwohl Vater Martin schon 62 Jahre alt war, erhielt er noch die Erlaubnis, sich als Arzt in Jerusalem niederzulassen. Sohn Hans hatte zu dieser Zeit bereits eine Stelle in der Abteilung für Bakteriologie an der Hebräischen Universität inne«, heißt es in der Dokumentation.
Fluchtwege Hans heiratete 1937 die aus Hannover stammende Bildhauerin Ellen Catzenstein. Die Arzttochter war 1933 über die Schweiz nach Italien geflohen und 1936 nach Jerusalem gekommen. Doch bis Ellen auch als Künstlerin arbeiten konnte und anerkannt wurde, vergingen zehn Jahre. So gab sie zunächst in Jerusalem Privatunterricht. 1947 konnte sie erstmals in einer Ausstellung ihre Arbeiten zeigen. Nach einem dreijährigen Forschungsaufenthalt in Amerika lehrte Hans schließlich weiter an der Hebräischen Universität und leitete zudem die staatlichen Labore in Jerusalem.
Paul Nathan war Chirurg. Er wurde 1899 in St. Wendel im Saarland geboren. Die Familie war säkular, der Vater Kaufmann. Im Ersten Weltkrieg hatte er wegen seiner starken Kurzsichtigkeit als Französisch-Übersetzer unter einem adeligen Offizier gedient. Nach dem Krieg studierte Nathan Medizin in Bonn und schloss das Studium 1921 in München ab. Zu seinen Wegbereitern gehörten der damals berühmte Internist Friedrich von Müller sowie der Pathologe Siegfried Oberndorfer, der ihn für die Chirurgie begeisterte. Erich von Redwitz riet ihm, als Jude Bayern zu verlassen und nach Berlin zu gehen.
In der Hauptstadt war er jedoch keineswegs sicher. Sanitäter warnten ihn, überstürzt verließ Nathan Berlin gerade noch rechtzeitig. »Nur zwei Tage nach seiner Flucht wollte die Gestapo ihn verhaften«, heißt es in seiner Biografie. Über Kleve, wo noch seine Eltern lebten, flüchtet er nach Holland und schließlich nach Edinburgh, wo er gemeinsam mit seinem Kollegen Harry Heller das schottische Ärzte-Diplom erwerben wollte, was ihm die Approbation ermöglichen würde.» Heller ging nach Palästina. Nathan schloss das Studium in Schottland ab und folgte 1934.
Siedler Auch Justin Weinschenk gehört zu den Medizinern, die beim Aufbau von Erez Israel halfen. Der praktische Arzt in Nürnberg hatte frühzeitig Hitlers Mein Kampf gelesen, seine Konsequenzen gezogen und 1934 Deutschland verlassen. «Die Freiheit der Lebensführung, die Unbekümmertheit der Kinder und das Leben in der jüdischen Gemeinschaft sind befriedigende Äquivalente für die Schwierigkeiten des Neuaufbaues der Existenz», schrieb er in einem Brief.
«Ob ich Arzt oder Siedler sein werde, soll die Entwicklung der nächsten Monate entscheiden», ließ Weinschenk seine Optionen offen und kaufte in Herzliya ein Haus mit Obstplantage und Hühnerstall. Doch Nachbarn und Freunde überredeten ihn, sich eine Zulassung als Arzt von der britischen Mandatsregierung ausstellen zu lassen. So richtete er in seinem Haus eine Praxis ein, in der er bis zu seinem Tod 1969 als Allgemein- und Notfallarzt praktizierte.
Finanzierung Die Biografien sind nüchtern geschrieben und dennoch außerordentlich spannend zu lesen. Erstellt wurde dieses Internetlexikon vom jüdischen Internet-Infodienst haGalil und dem Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. 60 Biografien sind bislang erschienen, und es sollen noch mehr werden. Doch um das realisieren zu können, fehlt Geld, bedauerte Jim Tobias vom Nürnberger Institut.
«Obwohl zahlreiche Ärzteverbände unsere Arbeit unterstützen, sind die finanziellen Mittel zwischenzeitlich aufgebraucht. Um unser Projekt weiterführen zu können, sind wir daher auf Spenden angewiesen.» Es würde sich wahrlich lohnen, weitere spannende Lebensgeschichten von deutsch-jüdischen Ärzten lesen zu können.
http://aerzte.erez-israel.de/