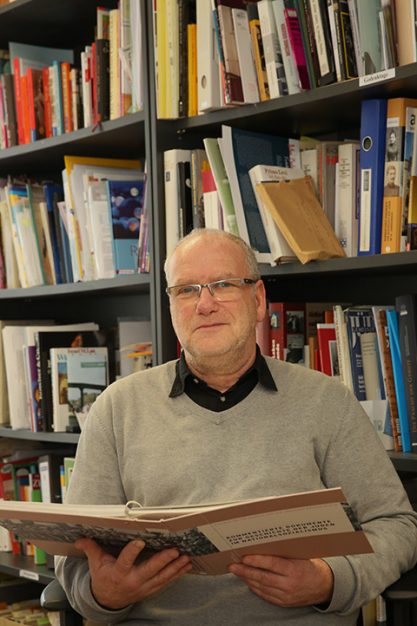Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätte ich sein Zoo- und Gartengeschäft übernehmen sollen. Das war im Saarland, in Homburg, wo die Familie meines Vaters seit Generationen lebte. Auch er wuchs hier bis 1935 auf, ehe er mit meinen Großeltern nach Palästina auswanderte.
In einem Café in Tel Aviv hat mein Vater dann meine Mutter kennengelernt, die mit ihrer Familie aus Wien gekommen war. Sie heirateten, und dort kamen meine beiden Schwestern zur Welt.
Nach dem Krieg wollte mein Vater in seine Heimat zurückkehren, und die lag für ihn im Saarland. Er war nun einmal deutsch sozialisiert und kultiviert. 1950 packten meine Eltern die Koffer. Für meine Mutter, die in Wien und Tel Aviv gewohnt hatte, war die saarländische Kleinstadt eine fremde Welt.
kindheit Hier kam ich 1954 zur Welt. Außer uns gab es in Homburg keine weitere jüdische Familie. Dort aufzuwachsen war mit der Schwierigkeit verbunden, eine jüdische Identität zu entwickeln, neben einer zionistischen, einer saarländischen und einer deutschen. Das ging gar nicht. Deshalb durfte ich schon relativ früh in den Sommerferien nach Israel zur Verwandtschaft reisen.
Bei uns war das Bücherregal voll mit Literatur über Israel. Irgendwie war das für uns das gelobte Land, in dem aber niemand aus meiner unmittelbaren Familie leben wollte. Doch im Jahr 1975 gingen meine Eltern nach Israel zurück.
Meine Frau habe ich an der Uni kennengelernt. Sie hatte eine große Affinität zum Judentum, und als für uns klar war, dass wir Kinder haben wollen, ist sie konvertiert. Sie hat die Härte des Giur auf sich genommen, und ich weiß nicht, ob ich das umgekehrt durchgestanden hätte.
religion Mich selbst würde ich einerseits als Jontef-Jude bezeichnen, andererseits bewege ich mich ständig in jüdischen Institutionen. Aber ich suche mir im Judentum eher die Kultur aus als die Religion. Wir begehen in der Familie neben den Feiertagen auch den Schabbat. Vor allem als unsere beiden Töchter noch im Erziehungsstadium waren, ist uns das wichtig gewesen, aber ich würde nicht sagen, dass ich sehr religiös bin.
Bei den Besuchen in Israel ist es etwas anders, weil meine Verwandten dort sehr religiös sind. Da machen wir das eben mit. Dabei stelle ich aber fest, dass sie zwar die Gebete beherrschen, meine Neffen an Pessach die Haggada herunterleiern, aber eine tiefere Reflexion über die Religion gar nicht vorhanden ist.
Andererseits ist es so, dass man in der Diaspora sensibler ist und ständig darüber nachdenkt, weil man immer befürchtet, es könnte etwas verlorengehen. In Israel denkt man hingegen nicht ständig darüber nach, wie man seine jüdische Identität sichern kann.
berufsleben Nach dem Studium in Mainz habe ich das Referendariat fürs Lehramt gemacht und bekam dann das Angebot, als Lehrer an der Lichtigfeld-Schule, also der jüdischen Schule hier in Frankfurt am Main, zu arbeiten.
Damals war die Schule noch in der Westend-Synagoge untergebracht. Dort habe ich eine erste Klasse übernommen – völlig ahnungslos, denn mit Grundschule hatte ich bis dahin noch nichts zu tun gehabt. Allerdings war schon klar, dass die Klassen 5 und 6 – das nannte sich »Förderstufe« – eingeführt würden, und auch, dass ich das organisieren soll.
Ich unterrichtete Jüdische Geschichte, Englisch und, weil man es nicht so eng gesehen hatte mit den Studienabschlüssen, auch andere Fächer. Da hatte ich es fast ausschließlich mit jüdischen Kindern zu tun. Es gab also für mich auch im Berufsleben einen jüdischen Bezugsrahmen. Die Kinder blieben bei uns bis zur sechsten Klasse. Ich hatte eingeführt, dass wir zum Abschluss mit den Eltern nach Buchenwald fahren.
Zunächst ist sehr heftig darüber diskutiert worden, ob man Kinder im Alter von zwölf Jahren damit konfrontieren sollte. Aber es wurde durchgeführt, und bis heute gibt es eine solche Reise in dieser Klassenstufe. Später gehörte ich der kollegialen Schulleitung an, was aber nicht so richtig funktionierte, und ich beschloss, die Schule zu verlassen. Außerdem suchte ich eine andere Herausforderung, als immer nur an derselben Schule tätig zu sein.
brennpunktschule Deshalb habe ich mich an eine Integrierte Gesamtschule in Preungesheim, einem Brennpunktbezirk in Frankfurt, versetzen lassen. Dort blieb ich zehn Jahre. Ich wechselte quasi von einem Ghetto in ein anderes – um es einmal etwas übertrieben auszudrücken. Das eine war das selbst gewählte im Schoß der Jüdischen Gemeinde, und in Preungesheim war es eben ein soziales Ghetto.
Aber bei den Schülern, die ich dort antraf, dachte ich: Dafür bist du Lehrer geworden! Der Gedanke war verbunden mit dem Gefühl: »Wenn man das durchsteht, kann einem im Lehrerdasein nichts mehr passieren.«
Ich erinnere mich an meine erste Stunde. Ich hatte die Schüler aufgefordert, Namenskarten zu schreiben, und einer hat »Adolf Hitler« auf die Karte geschrieben. Es gab sehr viele muslimische Schüler dort, und man wusste offenbar, dass ich Jude bin. Das war natürlich erst einmal ein Schock. Ich habe das dann aber nicht mit der Klasse kommuniziert, sondern habe den entsprechenden Schüler zu mir ins Büro bestellt und mit ihm gesprochen.
islam In dieser Zeit entstanden bei mir das Bedürfnis nach einem engeren Austausch wie auch die Neugier auf den Islam. Ich wollte wissen, wie fasten Muslime eigentlich während des Ramadan, wie feiern sie das Opferfest? Bei Klassenfahrten muss darauf geachtet werden, dass sie kein Schweinefleisch bekommen, weshalb sie auch keine Gummibärchen essen.
Da habe ich ganz viele Parallelen zum Judentum entdeckt, und ich muss sagen, ich konnte bei einigen die Religiosität verstehen – im Gegensatz zu den meisten anderen Lehrern. So sagten sie zum Beispiel zu muslimischen Schülern: »Wieso fastest du, du bist doch gar nicht religiös?« Diese Lehrer haben also für sich definiert, was Religiosität ist.
Als ich dann das Angebot bekam, ans Jüdische Museum zu wechseln, wurde ich im Bewerbungsgespräch nach meinen Vorstellungen zu Museumsarbeit befragt. Ich sagte, ich würde gern das Thema Islam mit einbringen – was ich dann auch in der einen oder anderen Form getan habe.
Fortbildungen Mein Auftrag vom Ministerium besteht darin, pädagogisch zu arbeiten und Wissen zu vermitteln. Dabei stoße ich bei Lehrern und Schülern gleichermaßen auf ungeheure Defizite. Noch immer existiert Wissen zum Judentum in einer Form, dass man annehmen könnte, es habe nie Juden in Deutschland gegeben.
Wenn ich mal eine Fortbildung über Religion mache, was eher selten der Fall ist, dann ist diese von allen Lehrerfortbildungen immer die am meisten besuchte. Da fragt man sich schon, wann sich an den Schulen endlich ein Wissen etabliert, auf das man zurückgreifen kann.
Jetzt haben wir eine neue Direktorin, die ganz viele Pläne hat, was die Vermittlung betrifft. Das finde ich total spannend. Ich arbeite in verschiedenen Arbeitsgruppen in Hinblick auf die neue Dauerausstellung im Rothschild-Palais mit. Man kann jetzt schon sagen, dass das ein anderes Museum werden wird als vorher.
reisen Einmal im Jahr reisen wir nach Israel, meine Frau und ich. Wir mieten dann für ein oder zwei Wochen eine Wohnung in Tel Aviv. Wir wohnen also bewusst nicht bei der Verwandtschaft, weil sie immer denken, sie müssten uns etwas Besonderes bieten, was ziemlich anstrengend ist.
Gern würden wir noch einmal nach Vietnam reisen, wo wir vor zwei Jahren gewesen sind. Es hat uns beiden dort sehr gut gefallen. Wir haben auch viele Freunde und Verwandte in den USA, die wir gelegentlich besuchen. Wir mieten uns dort eine Harley und fahren damit zwei Wochen durchs Land. Das ist die Art von Urlaub, die ich liebe.