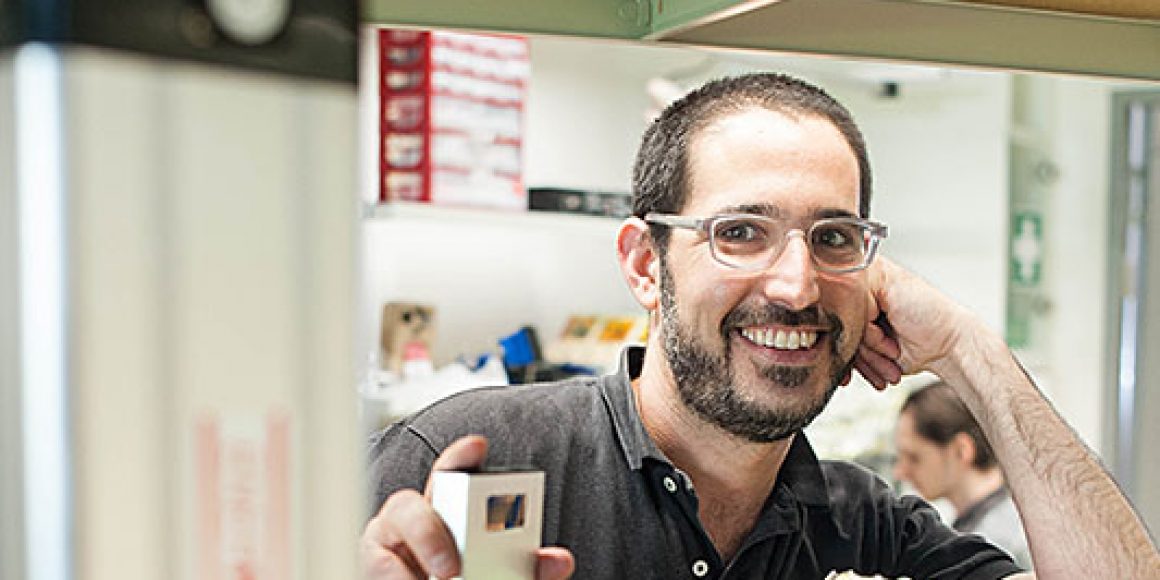Ich sehe mich als einen politischen Menschen. Aber ich bin weder links noch rechts. Mir geht es nur um Fakten, um Objektivität und um Menschlichkeit. Diese Haltung ist mir sehr wichtig – sowohl politisch als auch beruflich. Meine Firma stellt Akkus her, und das auf einem sehr hohen Niveau.
Trotzdem bieten Konkurrenten mitunter Produkte an, die die Anforderungen eines Kunden besser erfüllen, oder ein Konkurrent bietet ein gleichwertiges Produkt günstiger an. Dann empfehle ich meinen Kunden, dort und nicht bei uns zu kaufen. Deshalb vertrauen uns die Kunden. Sie nehmen uns als Spezialisten wahr und wissen, dass wir ihnen nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern sie auch zuverlässig beraten.
Herkunft Geboren wurde ich im Kibbuz Ramat HaKovesh eine halbe Autostunde nordöstlich von Tel Aviv. Die Familie meines Vaters kam aus Polen und zählte zu den Gründern des Kibbuz. Auch die Familie meiner Mutter kam aus Polen. Während mein Vater bereits in Israel geboren wurde, kam meine Mutter kurz nach dem Krieg in einer Sammelstelle der Jewish Agency in Bayern zur Welt. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass damals überall in Deutschland Mitarbeiter der Agency unterwegs waren und Überlebende suchten, um ihnen bei der Auswanderung nach Palästina zu helfen.
So kam meine Mutter mit ihren Eltern nach Israel und zog in denselben Kibbuz wie mein Vater. Dort haben sie sich kennengelernt, dort bin ich aufgewachsen, und dort habe ich später auch meine Frau kennengelernt. Sie ist eine deutsche Katholikin aus Paderborn und war als freiwillige Soldatin bei uns. Ihretwegen bin ich dann später, 1997, nach Deutschland gezogen. Aber meine beiden Brüder leben noch heute in dem Kibbuz.
Inzwischen lebe ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Berlin-Kreuzberg. Unsere Tochter ist weder getauft, noch ist sie Mitglied der jüdischen Gemeinde. Wir versuchen, ihr einfach alles zu zeigen und sie zu nichts zu zwingen. Irgendwann wird sie selbst entscheiden können.
Dennoch stört es mich, dass meine Tochter wohl nie als »vollwertige Jüdin« anerkannt werden wird, bloß weil ihre Mutter nicht jüdisch ist. Ich empfinde dieses Prinzip nicht nur als Entwürdigung, sondern auch als Anachronismus. In einer globalisierten Welt lässt es sich nicht verhindern, dass Juden mit Nichtjuden Kinder kriegen. Ich denke, das Judentum braucht da ein völlig neues Selbstverständnis. Wenn wir wollen, dass das Judentum überlebensfähig bleibt, müssen wir derartige Probleme pragmatisch angehen. Das fehlt uns momentan.
In meinen Augen ist es keine Frage, dass meine Tochter jüdisch werden kann, wenn sie es will. Sie kann meinetwegen auch jüdisch-katholisch sein. Darin sehe ich keinen Widerspruch. Aber letztendlich geht es darum, was sie glaubt, und nicht darum, in welche Schublade sie von anderen gesteckt wird. Ich bin der Ansicht, dass Menschen zwischen sich und Gott keinen Vermittler oder eine Gemeinde brauchen.
Kibbuz Für mich selbst spielt das Judentum keine sehr wichtige Rolle. Es ist lediglich die Religion, mit der ich geboren wurde. Ich esse auch nicht koscher. Aber gerade dadurch, dass ich in Berlin in einem jüdisch-katholischen Haushalt lebe, hat mein Judentum inzwischen schärfere Konturen angenommen. Meine Erziehung war, wie in Kibbuzim üblich, nicht sehr religiös. Auch meine Barmizwa war im Grunde nur der Höhepunkt eines Schuljahres mit mehreren Ausflügen an historische Orte.
In Israel konnte ich immer passiv an den Festen teilnehmen, ohne mir Gedanken darüber zu machen. In Berlin hingegen stellt sich mir immer wieder aufs Neue die Frage, ob ich die Feste feiern will und wenn ja, warum. Ich könnte statt Chanukka auch Weihnachten feiern, aber ich stelle fest, dass mir Chanukka wichtig ist – genauso wie es mir wichtig ist, an Weihnachten mit meiner Familie in die Kirche zu gehen.
Dieses Nebeneinander regt zum Nachdenken an. Und ich denke, darin liegt gewissermaßen eine neue Form des Judentums. Die tiefere Bedeutung derartiger Vielfalt habe ich erst in Berlin wirklich zu schätzen gelernt. Erst hier habe ich gemerkt, wie eingeschränkt mein Blick auf die Welt in Israel war. So hat es bestimmt zwei Jahre gebraucht, um mein Bild von Arabern und Muslimen von Grund auf neu zu prägen. Heute habe ich Freunde, die aus dem Iran, aus Syrien oder aus Palästina stammen. Gerade jetzt, wo der Hass in der Region erneut aufgeflammt ist, rede ich viel mit diesen Freunden, und diese Gespräche haben mir völlig neue Perspektiven eröffnet.
Ich hoffe, dass zurzeit eine Generation groß wird, die die alten Ängste und Denkmuster hinterfragt – sowohl auf arabischer als auch auf israelischer Seite. Aber für einen direkten Kontakt sind die Vorurteile wohl noch zu tief verankert. Daher bietet sich ein Ort wie Berlin an, wo Menschen einander begegnen können, ohne sich als Feinde gegenübertreten zu müssen.
Mit meinen Freunden frage ich mich manchmal, ob diejenigen, die von dem Krieg profitieren, mächtiger sind als jene, die darunter leiden. Kann es sein, dass dieser Konflikt lösbar wäre, wenn eine Lösung tatsächlich gewollt wäre? Seit Jahrzehnten treten wir auf der Stelle, ganze Generationen sind aufgewachsen, ohne jemals einen dauerhaften Frieden erlebt zu haben, und dennoch versuchen wir es immer wieder auf die gleiche Art und Weise.
Alle Konfliktparteien müssen verstehen, dass ein Frieden nicht ohne Kompromiss möglich ist, und es gehört zu einem Kompromiss dazu, Zugeständnisse zu machen, auch wenn diese schwerfallen. Aus einem Konflikt, in dem der Gegner nichts zu verlieren hat, kann man nicht als Sieger hervorgehen. Eine Politik, die das nicht erkennt, halte ich für ignorant.
Botschafter Ich frage mich: Was ist aus dem Wunder des jüdischen Staates geworden? Wo ist all die Hoffnung? Innerhalb von nur 20 Jahren nach seiner Gründung hatte sich Israel bereits zu einem modernen demokratischen Staat mit einer prosperierenden Wirtschaft und einer intellektuellen Elite entwickelt. Die ganze Welt blickte damals voller Bewunderung auf das kleine Land, in dem das jüdische Volk wie Phönix aus der Asche wiederauferstand.
Mit meinem Unternehmen ENERdan verstehe ich mich auch als so etwas wie ein branchenspezifischer Botschafter Israels. Ich will zeigen, dass Offenheit und Kreativität zu Erfolg führen. Bei uns arbeiten Juden, Christen, Muslime und Atheisten miteinander, ohne dass das je ein Problem gewesen wäre. Dennoch ist mein Unternehmen nicht dazu da, die Welt zu verbessern. Wir stellen Akkus her, und das wollen wir gut machen. Das Know-how dafür stammt von meinen Partnern aus Israel, und wir hier in Berlin haben die technischen Möglichkeiten. Ich will, dass bei uns israelische Kreativität und deutsche Gründlichkeit zusammenkommen. Dafür stehe ich jeden Morgen um sieben Uhr auf, telefoniere, schreibe E-Mails und spreche mit Käufern und Interessenten.
In der Wirtschaft wird Erfolg am Geld gemessen, und bisher hat sich unser Konzept eines weltoffenen Unternehmens bewährt. Derzeit haben wir zum Beispiel rund 15 Produkte bei Globetrotter im Angebot, darunter portable externe Reiseakkus für Kameras und Laptops. Dennoch bleibt meine Frau bei uns die Großverdienerin. Deshalb richte ich meine Arbeitszeiten so gut es geht nach ihr. Damit wir trotzdem beide arbeiten können, haben wir eine Babysitterin, die uns zweimal in der Woche unterstützt.
Momentan läuft die Firma so gut, dass ich expandieren könnte. Aber das will ich gar nicht. Ich will mich auf der Arbeit mit meinen Mitarbeitern wohlfühlen, und vor allem will ich Zeit mit meiner Familie verbringen können.
Aufgezeichnet von Benjamin Moscovici