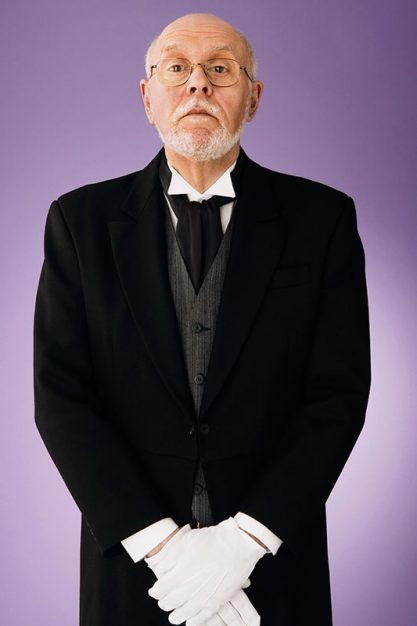Ki teze laMilchama» (Wenn du ausziehst in den Krieg) – ausgerechnet mit diesen Worten beginnt unser Wochenabschnitt, den Joseph Hertz, der frühere Oberrabbiner von London (1872–1946), «Gesetze über häusliches Leben und Menschenfreundlichkeit» nannte. Sogar der Tierschutz ist darin enthalten. Insgesamt sind hier sehr unterschiedliche Gesetze nacheinander aufgelistet. Viele davon mögen uns einleuchten: das Erbrecht, das Geländer um die Dachterrasse, der Umgang mit Fundsachen, der Lohn für den Arbeiter, der fristgerecht auszuzahlen ist.
Manches ist durchaus anrührend: die Würde eines Verstorbenen, sogar wenn er wegen eines Verbrechens hingerichtet worden war; die Sache mit dem Vogelnest – dass man nämlich die Vogelmutter nicht mit einfangen darf, wenn man schon ihre Eier aus dem Nest nimmt (was sich der Vogel dabei denkt, bleibt allerdings unberücksichtigt).
Anderes kommt uns vielleicht merkwürdig vor, wie das Schatnes- und Kilajimverbot. Und wieder anderes empört den Leser: Wie bitte – wenn einer zu viel isst oder trinkt, dann sei er des Todes und überdies von seinen eigenen Eltern anzuzeigen? Und ein Vergewaltiger, der muss das arme Mädchen, sollte es denn weder verlobt noch verheiratet sein, heiraten und darf sich nicht von ihr scheiden lassen? Ist das nicht eher eine schlimme Strafe für die Frau? Wo bleiben denn deren Rechte?
Und falls die Frau schon an einen Mann gebunden ist und sich die Vergewaltigung nicht irgendwo in Wald und Flur ereignet haben sollte, sondern in der Stadt – da soll man gar auf Ehebruch plädieren und beide Beteiligten schwer bestrafen, «sonst hätte das Mädchen ja geschrien»? Und was, wenn der Hilferuf ungehört – oder unbeachtet – geblieben ist?
Frauenrechte Manch einer der Kommentatoren sieht in dieser Parascha vor allem Gesetze zum Schutz der Frau – damit sie versorgt sei, wenn sie schon nicht mehr «ordentlich» heiraten könne. Und mancher sieht auch die Rechte des Vaters der Frau gewährleistet – damit ihm kein finanzieller Schaden entstehe, weil er für seine Tochter nicht mehr den vollen Brautpreis verlangen könne. Dass auch in früheren Zeiten ein Vater durchaus Verständnis für die problematische Situation seiner «entehrten» Tochter haben konnte, zeigt uns die parallele Aussage zu einem solchen Fall im 2. Buch Mose 22,16: «Wenn sich der Vater aber weigert, ihm seine Tochter zur Frau zu geben ...»
Wie ist dies in den Kontext der Gebote in unserer Parascha einzuordnen? Oberflächlich betrachtet finden wir in Ki Teze eine Aneinanderreihung von Gesetzen, die miteinander nichts oder nur wenig zu tun haben. Auch auf den zweiten Blick erschließt sich der rote Faden nicht so leicht.
Der mittelalterliche Kommentator Raschi (1040–1105) sieht es so: Wenn einer sich im kleinen schon ethisch korrekt, also menschen- und tierfreundlich verhält (zum Beispiel im Umgang mit dem Vogelnest), wird ihm der Ewige Segen für seiner Hände Werk verleihen (damit er sich einen Weinberg kaufen kann – in dem nun wiederum nicht zweierlei Arten anzubauen sind), und schließlich wird er zu Wohlstand gelangen (und er wird sich ein Haus leisten können, mit einer Dachterrasse, um die dann ein Geländer zu bauen ist).
Raschi drückt sich hier bewusst vereinfacht und mit den Sprachbildern und Denkmustern seiner Zeit aus. Ein moderner Kommentar der amerikanischen Bibelwissenschaftlerin Adele Berlin sieht dagegen klar den Status der Frauen als Dreh- und Angelpunkt dieser Parascha; wieder andere sprechen davon, hier werde ein idealistisches Gesellschaftsbild skizziert.
Üble Nachrede Was ist denn nun der rote Faden? Und – haben alle diese Gesetze wirklich etwas miteinander zu tun, oder werden sie nur einfach nacheinander aufgezählt: von der Erfüllung von Gelöbnissen bis hin zum Anlegen einer ordentlichen Latrine? Zwei Schlüsselaussagen gibt es in dieser Parascha, beide werden jeweils zweimal genannt: Da ist zum einen die Aufforderung, «das Böse aus deiner Mitte» fortzuschaffen. Und zum anderen ist es das zweimalige «Sachor» – gedenke dessen, was Mirjam passiert ist; sie wurde mit Aussatz bestraft für üble Nachrede, was eine Bedrohung des Volkes von innen darstellte. Und gedenke dessen, was dir Amalek angetan hat – Amalek, der Bedroher von außen.
Wie schafft man es fort, das Böse? Hinter all den in unserer Parascha aufgeführten Gesetzen steht noch eine tiefere Ebene; sie haben einen gemeinsamen Nenner: Verantwortlichkeit im Handeln an uns und unserer Umwelt, in unserem eigenen Handeln genauso wie in der Achtsamkeit gegenüber anderen. Dabei ist es egal, ob der andere mir gleichgestellt ist oder ob er ärmer ist als ich oder ein Sklave oder gar ein Verbrecher; und sogar Tiere haben Rechte. Es geht um die Wahrung der Würde; meiner eigenen und auch der Würde der anderen Geschöpfe.
Kriegsgefangene Das Mädchen auf dem Feld oder die schöne Kriegsgefangene – ein Mann kann sie sich nicht einfach zur Befriedigung seiner Lust nehmen und sie dann quasi wegwerfen wie einen Gegenstand, sondern er wird gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Der junge Mann, der ein «Fresser und Säufer» ist, ausschweifend und unmäßig, soll veranlasst werden, sich selbst gegenüber verantwortlich zu handeln.
Der entlaufene Sklave soll frei bei uns leben und für sich selbst arbeiten dürfen. Wenn man Besitz hat, verwende man ihn zum Nutzen und nicht zum Schaden des Nächsten; und wir sollen auch nicht geizig oder habgierig sein; es heißt: Zahle versprochenen Lohn aus, nimm dem Armen nicht noch das letzte Hab und Gut, und denke daran, dass auch ein Arbeitstier ordentliches Futter und entsprechende Ruhepausen braucht! Und wenn einer deine Hilfe braucht, dann schau nicht weg! Steh dem bei, der um Hilfe ruft, genauso wie dem, der nicht in der Lage ist, um Hilfe zu rufen! Sei achtsam!
Und warum beginnt unsere Parascha ausgerechnet mit Ki teze laMilchama? Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888) gibt uns die Antwort: «Was in allen diesen Problemen dem jüdischen Gewissen selbst für Ausnahmezustände (wie zum Beispiel im Krieg) zur Pflicht gemacht wird, gilt selbstverständlich in noch höherem Maße für die Zustände des normalen Lebens», schreibt er.
Zeichnet der Wochenabschnitt das Bild einer idealen Gesellschaft? Sicherlich. Aber es ist an uns, an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Wir sind dafür verantwortlich, das Böse aus unserer Mitte wegzuschaffen – und aus uns selbst.
Die Autorin ist Rabbinerin der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg.
Inhalt
Im Wochenabschnitt Ki Teze werden Verordnungen wiederholt, die Familie, Tiere und Besitz betreffen. Dann folgen Verordnungen zum Zusammenleben in einer Gesellschaft, wie etwa Gesetze zu verbotenen sexuellen Beziehungen, dem Verhalten gegenüber Nicht-Israeliten, Schwüren und der Ehescheidung. Es schließen sich Details zu Darlehen, dem korrekten Umgang mit Maßen und Gewichten sowie Sozialgesetze an.
5. Buch Mose 21,10 – 25,19