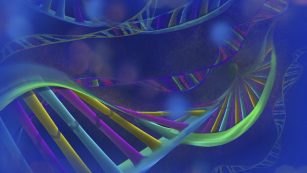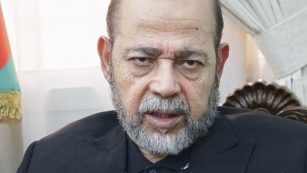Die jüngsten Ausschreitungen in Bern, bei denen eine propalästinensische Demonstration in hasserfüllte Gewalt umschlug und antisemitische Parolen zu hören waren, werfen ein grelles Licht auf eine beunruhigende Leerstelle im politischen Diskurs: das Schweigen der Linken. Während rechte Hetze zu Recht Empörung und Distanzierung hervorruft, bleibt es auffallend still, wenn der Hass aus den eigenen ideologischen Milieus kommt.
Diese Zurückhaltung ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer langen Tradition. Seit den 1970er-Jahren pflegt die europäische und auch die Schweizer Linke ein emotionales Verhältnis zu Palästina. Was einst als Ausdruck von Antikolonialismus und Solidarität mit »unterdrückten Völkern« begann, hat sich zu einer politischen Gewohnheit verfestigt, die kaum noch reflektiert wird. Die Palästinenser wurden zum Symbol einer globalen Opferrolle stilisiert – Israel hingegen zum Sinnbild westlicher Macht.
Bis zum Sechstagekrieg war die Begeisterung für Israel in der Schweiz noch deutlich spürbar. Danach drehte der Wind. Die palästinensischen Terrorakte förderten in der offiziellen Schweiz das Bewusstsein, die Schweiz müsse zur Lösung des Nahostkonflikts betragen, um palästinensische Terrorakte zu verhindern. Auch Israel habe hier Opfer zu bringen, so eine weit verbreitete Meinung. Damit manifestierten sich die Narrative, die von Befreiung und Unterdrückung sprechen, in gesellschaftlichen Denkweisen ein.
Seit den 1970er-Jahren pflegt die Schweizer Linke ein emotionales Verhältnis zu Palästina.
Doch diese symbolische Lesart ignoriert, dass sich der Nahostkonflikt kaum in Kategorien von »Befreiung« und »Unterdrückung« erklären lässt. Wer heute noch immer reflexhaft Partei für »Palästina« ergreift, ohne die antisemitische Rhetorik vieler ihrer Vertreter zu benennen, handelt nicht aus Solidarität, sondern aus ideologischer Trägheit.
Dass Teile der Linken bis heute Mühe haben, Antisemitismus klar zu benennen, wenn er aus den moralisch »richtigen« Kreisen kommt, ist Ausdruck von Doppelmoral. Die gleichen politischen Stimmen, die sonst mit moralischer Entschiedenheit für Menschenrechte eintreten, verlieren ihre Stimme, sobald die Täter nicht in ihr Weltbild passen. Man fürchtet offenbar, historische Symbole und alte Gewissheiten infrage zu stellen – und nimmt dafür in Kauf, die eigenen Werte zu kompromittieren.
Antisemitismus ist keine Frage der politischen Richtung, sondern eine Konstante des Hasses.
Auch in der Schweiz zeigt sich dieses Muster deutlich. Nach der gewaltsamen Demonstration in Bern folgten von linker Seite vor allem Relativierungen. Die Stadtpräsidentin blieb vage, die Parteien von SP bis Grüne sprachen von »Einzelfällen« oder »emotionaler Überhitzung« – als ginge es nicht um gezielten Judenhass mitten in der Bundeshauptstadt.
Dass inzwischen mehrere der von der Hamas entführten Geiseln nach monatelanger Gefangenschaft freigekommen sind und der von vielen Seiten langersehnte Waffenstillstand eingetreten ist (mit Blick auf einen längerfristigen Frieden), scheint für viele keine Zäsur zu sein. Während sich in Israel Familien um die zurückgekehrten Geiseln kümmern oder um die toten Geiseln trauern, vermeidet man hierzulande jedes klare Wort über die Täter. Man will schließlich »nicht polarisieren« – und polarisiert gerade dadurch.
Der Preis dieses Schweigens ist hoch. Denn Antisemitismus ist keine Frage der politischen Richtung, sondern eine Konstante des Hasses, die immer wieder neue Formen findet. Eine Linke, die sich moralische Glaubwürdigkeit bewahren will, muss den Mut haben, auch den eigenen Schatten zu betrachten – und klar zu sagen, dass der Hass auf Jüdinnen und Juden nie ein legitimer Ausdruck von Empörung sein kann.
Die Solidarität mit Palästina mag einst Ausdruck eines humanistischen Impulses gewesen sein. Heute aber steht sie dort, wo sie unkritisch, undifferenziert und blind gegenüber Antisemitismus bleibt, im Widerspruch zu genau jenem Humanismus, den sie zu vertreten vorgibt. Das Schweigen der Linken ist daher nicht nur ein politisches Versagen. Es ist ein moralisches.
dreyfus@juedische-allgemeine.de