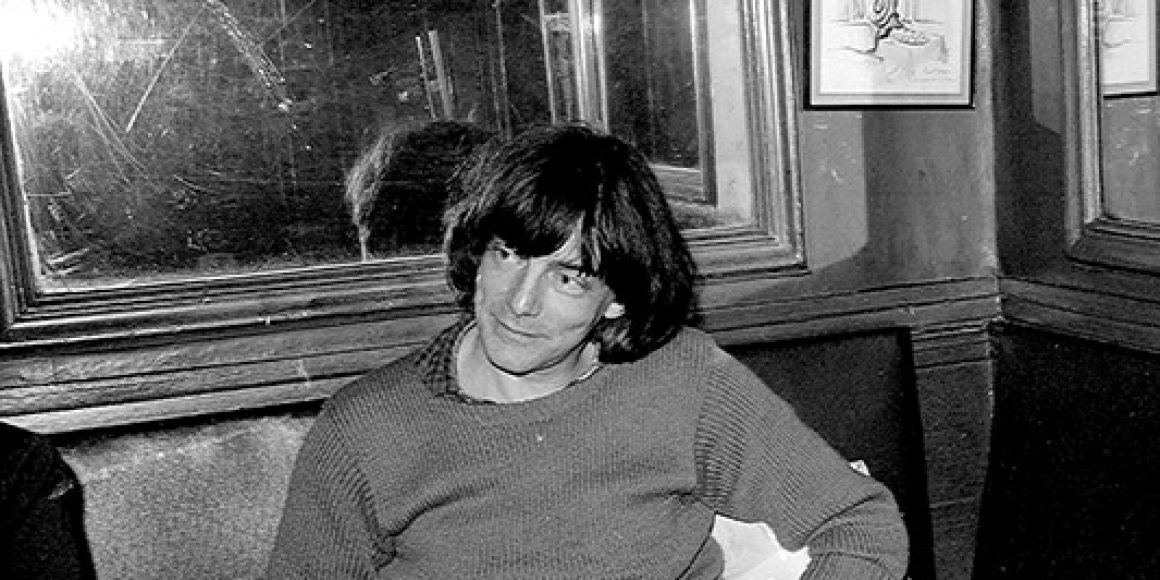Die neue Studie von Sebastian Voigt ist von der ersten bis zur letzten Zeile fesselnd. Es geht nicht nur um biografische Skizzen von Pierre Goldman, Daniel Cohn-Bendit und André Glucksmann. Voigt entwirft ein Porträt von in Frankreich nach 1945 unterdrückten jüdischen Narrativen, die auch Anteile kollektiver jüdischer und linker Erfahrungen in Europa in sich bergen.
Unterdrückt waren diese Narrative in Frankreich deshalb, weil die Mehrheit der Franzosen ihre Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoa bis 1968 vorrangig im Kontext einer umfassenden französischen Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer interpretierte, die die Auslieferung der Juden an die Deutschen ausblendete.
Der in der Bundesrepublik nahezu unbekannte Schriftsteller Pierre Goldman nahm sich ein Leben lang den Kampf seiner von Polen nach Frankreich emigrierten jüdisch-kommunistischen Eltern zum Vorbild, die sich in Frankreich dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung angeschlossen hatten. »Frankreich war«, so Sebastian Voigt, »für Goldman nicht mehr das Land von 1789, sondern das Land der Kollaboration und der Deportationen. Er konnte keinen Frieden mit den Verhältnissen schließen, die die Juden nach Auschwitz gebracht hatten.«
Nach Aktivitäten im kommunistischen Studentenverband und einer lateinamerikanischen Guerillabewegung driftete Goldman ins kriminelle Milieu ab. Seine 1975 erschienenen Dunklen Erinnerungen wurden zu einem Schlüsselbuch für radikale jüdische Linke in Frankreich.
Antitotalitär Auch die Eltern des Philosophen André Glucksmann kamen aus Osteuropa. In Prag und Czernowitz in eher nichtreligiösen Familien geboren, wanderten sie als Kommunisten von Wien nach Palästina aus und gingen 1930 nach Deutschland, wo sie sich dem antifaschistischen Kampf anschlossen, um dann, als Hitler an die Macht kam, nach Frankreich zu fliehen. Glucksmanns Vater wurde 1940 umgebracht, seine Mutter schloss sich dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung an und ging nach dem Krieg nach Wien zurück.
Glucksmann wurde nach dem »Solschenizyn-Schock« zum wichtigsten Repräsentanten der antitotalitären Wende vieler 68er in Frankreich. Ohne die Auseinandersetzung mit seinem Vater, dem kommunis-tischen Funktionär Rubin Glucksmann, und seinem Mentor Raymond Aron wäre diese antitotalitäre Wendung des Kommunisten und Maoisten Glucksmann nicht denkbar gewesen.
Die Eltern von Daniel Cohn-Bendit entstammten assimilierten deutsch-jüdischen Familien. Sie flohen 1933 nach Paris. Ihre Staatsangehörigkeit wurde ihnen vom NS-Regime aberkannt. Cohn-Bendit kam deshalb 1945 in Frankreich als Staatenloser zur Welt. Sein intellektuelles Denken wurde deutlich beeinflusst von Ernest Jouhy und Hannah Arendt, die beide mit den Eltern Cohn-Bendits verbunden waren. Insbesondere der Einfluss Hannah Arendts auf das Denken Cohn-Bendits wurde, wie Voigt zeigt, lange unterschätzt.
Als am 22. Mai 1968 Tausende gegen die Ausweisung Cohn-Bendits aus Frankreich unter der Losung »Wir sind alle deutsche Juden« auf die Straße gingen, wurde damit auch der Beginn einer anderen Auseinandersetzung Frankreichs mit seiner Vergangenheit unter der deutschen Besatzung gesetzt.
Widersprüche Was diese Studie so spannend und zu einem derart erregenden Lektüreereignis macht, sind die vielen ineinander und miteinander verschränkten Biografien, die aufgeblättert werden.
Es geht hier nicht um die Einflüsse jüdischen Geisteslebens auf den Mai ’68 in Frankreich, sondern um die Auseinandersetzung mit drei wesentlichen Repräsentanten, die in ihrem Engagement und Denken verschiedene historische Erfahrungen ihrer jüdischen Eltern adaptieren, aufgreifen oder reflektierend über Bord werfen und damit zugleich den öffentlichen Diskurs in Frankreich über die Zeit der Besatzung nachhaltig beeinflussen.
Resümierend schreibt Voigt: »Alle drei (Goldman, Cohn-Bendit und Glucksmann; Anm. d. Red.) waren sich der Widersprüche zwischen dem Versprechen des Kommunismus beziehungsweise Linkssozialismus, dem ihre Eltern gefolgt waren, und des realen Geschichtsverlaufs bewusst. Der Zivilisationsbruch und die Verbrechen des Stalinismus machten ein direktes Anknüpfen an das Engagement der Vorgängergeneration unmöglich.«
Sebastian Voigt: »Der jüdische Mai ’68« (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, Bd. 22, hg. v. Dan Diner). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, 383 S., 69,99 €