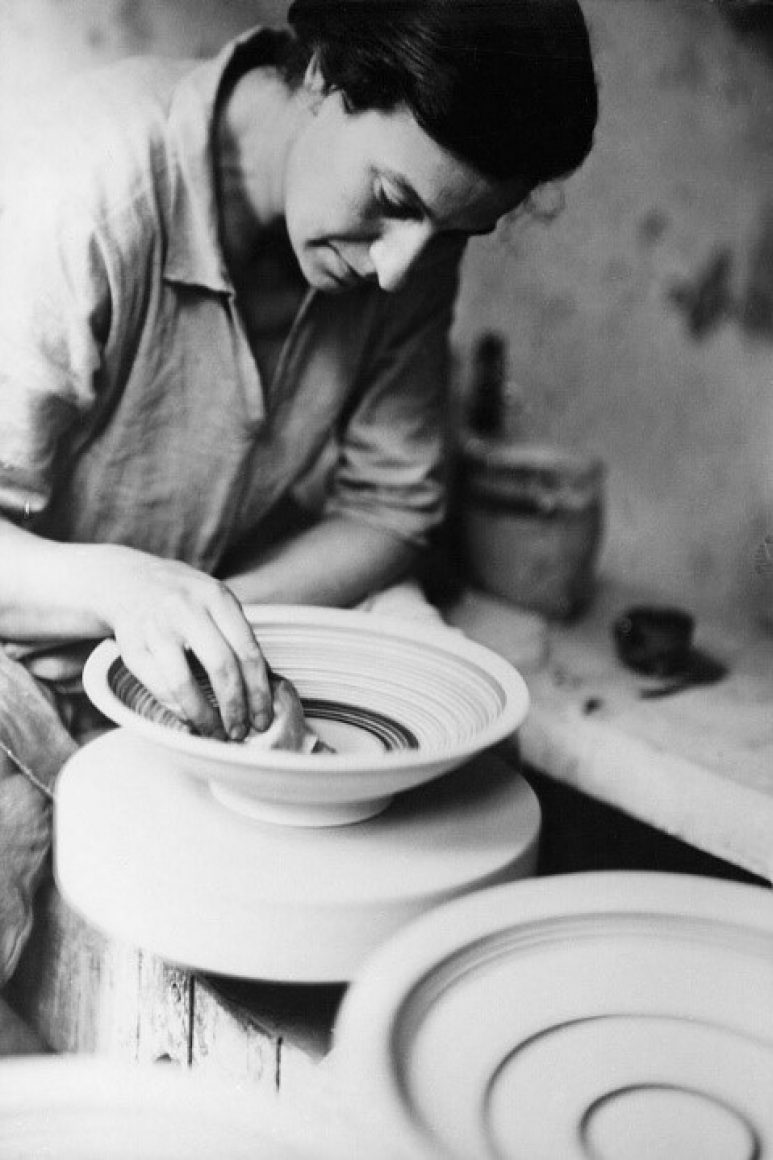Sie hat zwischen Spinnen und Staub in Tel Aviv im Müll gewühlt, die Dachböden von Familien durchsucht, die dort Artefakte ihrer längst vergessenen und früher vielleicht einmal berühmten Großmütter vermuteten. Und sie hat über Jahre in Archiven recherchiert, um mühsam ihre Namen und Adressen zu identifizieren, sie zu enträtseln und in Verbindung zu bringen. Sie hat Flohmärkte besucht und ist jeder Spur nachgegangen, die zu den Keramiken, den Holzschnitten, dem Modedesign oder den Grafiken sowie der Textil-, Gold- und Silberschmiedekunst jüdischer Designerinnen der Moderne führte.
Seit nunmehr 20 Jahren sucht und findet die Kunsthistorikerin und Kuratorin Michal Friedlander unzählige Gegenstände, darunter Taschen, Hüte, Uhren, Puppen, Perlenstickereien, Geschirr, Sederteller, Plakate, Entwürfe, Druckgrafiken, Illustrationen, Teeservice und Automaten – allesamt Dinge, die von Künstlerinnen geschaffen wurden, an deren Namen sich fast niemand mehr erinnert. Und trotzdem prägen sie mit ihrer radikalen Modernität unser Formempfinden bis heute.
Friedlander, seit 2001 zuständig für Judaica und angewandte Kunst im Jüdischen Museum Berlin, ist bei ihrer Recherche stets diskret vorgegangen. Es gab keinen Markt für die Kunst und das Kunstgewerbe jüdischer Designerinnen, ein Umstand, der sich mit dieser Ausstellung im Jüdischen Museum allerdings grundlegend ändern wird.
Ohne jede Übertreibung spektakulär
Denn mit ihren rund 400 Exponaten von 60 Künstlerinnen ist sie ohne jede Übertreibung spektakulär, und das aus zahlreichen Gründen. Zunächst erschüttert die simple Tatsache, dass die schlichte Schönheit sowie die Wertigkeit der Kunst- und Gebrauchsgegenstände uns in ihren Bann ziehen, aber ihre Schöpferinnen so gut wie unbekannt sind.
Immer wieder steht man verblüfft vor Alltagsgegenständen, beispielsweise einem Tortenheber, der in seiner Gestaltung als silberner Halbkreis an einem schmalen Griff und seinen Proportionen formschöner ist als alle bekannten Kuchenbestecke. Oder vor einem Chanukkaleuchter auf neun zarten silbernen Ringen.
Den Namen der Schöpferin dürften – wenn überhaupt – wenige Experten je gehört haben: Rose Leon. Die Silberschmiedin, 1909 in Berlin geboren, hat an der Schule Reimann im Fachbereich Metallarbeit jüdische Zeremonialobjekte entworfen und gefertigt. Wie alle anderen jüdischen Designerinnen verlor auch sie nach 1933 Arbeits- und Ausstellungsmöglichkeiten. Ihr gelang als eine der wenigen die Flucht in die USA, jedoch konnte Leon nicht mehr an die Erfolge ihre Berliner Zeit anknüpfen. Bis jetzt war ihr Name weitestgehend vergessen.
Die Gegenstände ziehen in ihren Bann, aber ihre Schöpferinnen kennt niemand.
Ebenfalls in der privaten Schule Reimann, die von den Nazis 1938 in der Pogromnacht verwüstet wurde, war Alice Neumann tätig. Ihre Modezeichnungen für den Ullstein Verlag machten sie berühmt, ihre gezeichneten »Frauen in Sportkleidung« beweisen eine zeitlose Eleganz. Geboren als Alice »Lissy« Edler, zeigte sie bereits in sehr jungen Jahren ein überbordendes künstlerisches Talent. Ihre Karriere endete mit der überstürzten Flucht nach London. Dort konnte Neumann ihre Familie zunächst mit ihrer Kunst ernähren, doch dann, auch dies ein typisches Frauenschicksal, unterstützte sie ihren Mann beim Aufbau seiner Arztpraxis. Ihr Name ist heute so gut wie vergessen.
Die Holzbildhauerin, Maskenschnitzerin und Bühnenbildnerin Marianne Heymann ist eine weitere faszinierende Künstlerin, die heute so gut wie niemand kennt. Weil sie Paul Klee, ihren Lehrer am Bauhaus, bewunderte, schnitzte sie eine Handpuppe mit dessen strengen Gesichtszügen und großen Augen sowie weißem Kittel. Heymann gelang die Flucht nach Haifa.
Flucht, Deportation, Ermordung
Wenigstens, so könnte man argumentieren, haben diese Designerinnen ihr Leben retten können – aus dem kulturellen Gedächtnis sind sie jedoch entschwunden. Andere hatten nicht so viel Glück, sie wurden ermordet. Oder sie begingen aus Furcht vor der Deportation Selbstmord wie 1942 die »Blumendichterin« Franziska Bruck, die das Blumenbindehandwerk revolutioniert hat. Ein Bewunderer ihrer Arbeit scherzte: »Franziska Bruck ist die berühmteste Persönlichkeit von Berlin, denn sie hat Unkraut salonfähig gemacht.« Inspiriert von Ikebana und dem japanischen Minimalismus, hatte sie sogar eine Schule für Blumenschmuck in Berlin-Charlottenburg gegründet.
Die Porträtmalerin und Kinderbuchillustratorin Elly Frank wurde beim Massaker von Rumbula in Lettland erschossen. Ida Dehmel, Mäzenin und Perlenstickerin, beging 1942 Suizid. Ihre Arbeiten sind bezaubernd filigran und poetisch. Franziska Schlopsnies, so lesen wir in dem liebevoll wie detailliert gestalteten Katalog, gilt als eine der bedeutendsten Modegrafikerinnen der 1920er-Jahre. Sie hatte zahlreiche Titelblätter großer Magazine gestaltet, ihre Gouachemalerei »Die elegante Frau« gehört definitiv zu den Highlights der Ausstellung. Im Dezember 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet.
Und der Hut aus schwarzem Samt mit weißem Vogel von Paula Schwarz ist eine Mode-Ikone auf der Ausstellung, seine Macherin wurde 1943 in Theresienstadt umgebracht.
Sie alle waren Pionierinnen in einem gesellschaftlichen Umfeld, das Frauen die Fähigkeit zur Kreativität absprach. Wenn überhaupt, konnte man als Amateurin ein wenig dekorativ arbeiten, nie aber wirklich schöpferisch, hieß es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. »Diese Abwertung schränkte sie ein«, betont Michal Friedlander. »Die Nischen, die sie sich suchten, boten ihnen aber auch Chancen.«
Viele Jüdinnen studierten an Kunstakademien. Frauen waren meist erst nach 1919 zugelassen.
Die Künstlerinnen arbeiteten teilweise in den eigenen vier Wänden, verkauften privat oder an Haushaltswarengeschäfte und gründeten ihre eigenen Unternehmen. Trotz der gesellschaftlichen Marginalisierung erwarben sie sich bis 1933 herausragende Positionen, und zwar künstlerisch und oft auch wirtschaftlich. Gegen die gesellschaftlichen »Widerstände«, daher der Titel der Ausstellung.
Sie kämpften nicht nur um Anerkennung und, oft aus der Not heraus, um finanzielle Unabhängigkeit – auch angestaubte Wertvorstellungen galt es zu überwinden, und das außer- und innerhalb ihrer jeweiligen jüdischen Lebenswelt. All diese »Widerstände« zeigt das erste der in zehn thematische Kapitel gegliederten Ausstellung.
So sollte Frauen bis 1919 der Zugang zu fast allen Kunstakademien in Deutschland verwehrt bleiben. Als das Studium dann möglich wurde, waren Jüdinnen überproportional vertreten, da sie zumeist aus bürgerlichen Familien stammten, in denen Bildung, Kunst und finanzielle Unabhängigkeit besonders hoch geschätzt wurden.
Die private Schule Reimann hatte mehr als 15.000 Absolventinnen und Absolventen
So gründete das jüdische Kunstwerkerpaar Albert und Klara Reimann 1902 die gleichnamige Schule. Was ihren Fächerkanon und die Studierendenzahlen betraf, so war sie größer als das Bauhaus – trotzdem ist sie heute weitestgehend in Vergessenheit geraten. Unterrichtet wurden dort nicht nur Malerei und Bildhauerei, sondern bald auch Modezeichnen, Grafik, Plakatkunst, Batik, Buchbinden, Lederschnitt, Metallbearbeitung sowie Fotografie und Schaufenstergestaltung. Mehr als 15.000 Absolventen und Absolventinnen zählte man bis 1943, als die Reimann-Schule bei einem Bombenangriff zerstört wurde.
»Unser Anliegen ist es«, so Friedlander, »deutsch-jüdischen Designerinnen Sichtbarkeit und Anerkennung zu verschaffen und die Geschichtsschreibung dort, wo sie ausgeschlossen wurden, zu korrigieren.« Natürlich unterscheide sich eine von einer jüdischen Frau entworfene Teekanne nicht von einer, die eine nichtjüdische Frau gestaltet hat. Das essenziell Andere, glaubt Friedlander, zeige sich vielmehr in dem gesellschaftlichen Kontext, aus dem die jüdische Kulturproduktion hervorgegangen sei.
Die Künstlerinnen lösten sich, so Friedlanders These, »aus der warmen Umarmung ihres Herkunftsmilieus und stiegen an die Spitze ihres jeweiligen Berufsfelds auf«.
Allein Anni Albers und ihren abstrakten Webarbeiten, die sie zu einer der einflussreichsten Textilkünstlerinen des 20. Jahrhunderts machten, wurde jener Ruhm zuteil, der so vielen jüdischen Designerinnen eigentlich gebühren würde. Das MoMA in New York hat ihr 1949 als erster Textilkünstlerin eine Einzelausstellung gewidmet.
Aber immerhin: »Widerstände« sorgt jetzt dafür, dass eine Leerstelle in der deutsch-jüdischen Kulturgeschichte endlich verschwindet. Die Ausstellung ist zweifellos ein Glücksfall zu nennen.
»Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne«. Bis 23. November im Jüdischen Museum Berlin