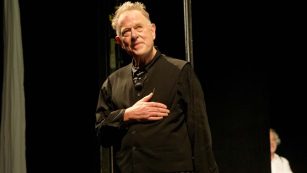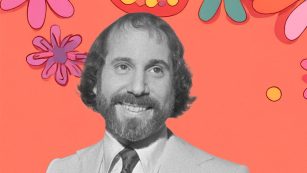Dieses Buch zu schreiben, sagt Zeruya Shalev, sei die anspruchsvollste Aufgabe ihres Autorinnenlebens gewesen. »Es war himmlisch und zugleich eine Höllenqual.« Tatsächlich führt Shalev in Schicksal – so heißt der neue Roman der israelischen Bestsellerautorin durchaus berechtigt – ihre Protagonistinnen in so existenziell wie emotional herausfordernde Situationen, dass sie mit bloßer Vernunft weder zu verstehen noch zu bewältigen sind. Es gibt etwas »Höheres« in diesem Roman, das unsichtbar wirkt, jenseits der Vernunft, und stets präsent ist in der tragischen Geschichte von zwei unterschiedlichen Frauen und ihren Familien.
Die eine Frau lebt in einer Siedlung nahe Jerusalem: Sie heißt Rachel und ist um die 90. Als 15-Jährige war sie in den Untergrund gegangen, wollte als Mitglied der paramilitärischen Untergrundorganisation Lechi die Gründung des jüdischen Staates im Mandatsgebiet Palästina beschleunigen. Sie brach mit ihren Eltern, half bei Attentaten auf britische Soldaten, ist kämpferische Zionistin und fühlt sich auch im hohen Alter immer noch Idealen und Kampfgefährten von damals verbunden – denen, die es ihrer Ansicht nach »mit Willenskraft und Scharfsinn« geschafft hatten, das Land von der britischen Herrschaft zu befreien. Und dafür keinen Dank erhielten, sondern der israelischen Geschichtsschreibung ungerechterweise als Terroristen galten.
»Schicksal« ist Zeruya Shalevs bislang politischster Roman.
Im Roman liest sich das dann so: »Sie waren die Leute mit Verstand, im Gegensatz zu jenen Kleinhirnen, angeführt von Ben Gurion, hinter dem der gesamte feige Jischuw stand.«
Rachel ist Witwe und einsam. Sie hat zwei Söhne, doch das Verhältnis zu beiden ist belastet. Jair, der Erstgeborene, lebt in Yaffo und will die Mutter nicht besuchen. Die Lechi sei eine »Horde wahnsinniger Extremisten« gewesen, die Mutter habe ihn als Kind vernachlässigt, und er fahre nicht in besetztes Gebiet. Der jüngere Bruder Amichai hingegen ist religiös geworden, ein Chassid, der ständig die Worte Rabbi Nachmans von Bratzlaw im Mund führt.
liebe Rachels Trauma ist ihr erster Ehemann – die Liebe ihres Lebens, auch er Mitglied der Lechi, der sie aber bald nach der Hochzeit abrupt verließ. Später wurde dieser Mann ein angesehener Wissenschaftler. Und der Vater von Atara. Sie ist die andere Frau, deren Leben Zeruya Shalev schildert. Über seine erste Ehe hat Ataras Vater nie etwas erzählt. Auch nicht über den Schicksalsschlag, der Menschenleben kostete, ihn selbst fast ums Leben gebracht und veranlasst hatte, Rachel zu verlassen.
Atara ist knapp 50, Architektin im arabisch-jüdischen Haifa, Mutter einer Patchworkfamilie. Und in der Midlife-Crisis. Die Tochter aus erster Ehe studiert in den USA. Mit ihrem zweiten, älteren Mann hat sie einen gemeinsamen Sohn, der Elitesoldat in der Armee ist. Atara versucht nach dem Tod ihres Vaters, mehr über dessen Vergangenheit zu erfahren. Und trifft dabei auf Rachel.
Es sind Liebe, Tod und die Geschichte ihres Landes, die die beiden Frauen unausweichlich miteinander in Berührung bringen. Während Atara versucht, die Geschichte ihres Vaters zu rekonstruieren, gerät ihr eigenes Leben aus den Fugen. Auch sie wird von einem Schicksalsschlag getroffen.
Schicksal ist ein metaphysisches Billardspiel: Die Autorin stößt eine Kugel an. Rollt die erst einmal, sind Dynamik und Richtung nicht mehr zu beeinflussen. Zeruya Shalev folgt also vielmehr ihrer Eingebung und der Logik ihrer Figuren als einem festgeschriebenen Plan. Das macht auch diesen Roman wieder so lebendig. Er ist bei allen Konflikten keine Gerichtsverhandlung. Jede Figur kommt zu ihrem Recht. Ihr Handeln, ihre Gefühle werden nicht bewertet. Aber es ist so eindringlich dargestellt, dass endgültige Parteinahme schwerfällt. Das ist besonders bemerkenswert, weil die Autorin diesmal einzelne Biografien zwingend mit der Vergangenheit und Gegenwart des Staates Israel verknüpft.
israel Über die Geschichten ihrer Protagonistinnen spannt sie einen Bogen vom vorstaatlichen Israel bis heute. Und lässt debattieren: Gab es damals nach Rachels Ansicht eine Vision, Mut, Ideale und Kraft, um den Staat zu errichten, so scheint er heute von Rissen durchzogen, disparat und desorientiert. Hektik und Staus prägen Ataras Alltag, Gereiztheit, Missgunst, Enttäuschung, Verzweiflung und Unsicherheit. Narben des Schweigens oder sich immer neu entzündende Wunden machen allen das Leben schwer. Der Stress offenbart sich in den Familien. In den Häusern von Yaffo oder Haifa, in den Siedlungen hinter Jerusalem rumoren ungelöste Konflikte zwischen Generationen, Eltern, Kindern, Ehepartnern.
Der Roman demontiert ein weibliches Klischee nach dem anderen.
Schicksal ist Zeruya Shalevs bislang politischster Roman. Bekannt ist die Autorin für sinnliche, suggestive Sprache, poetische Kraft und ihr tiefes Verständnis seelischer Abgründe, für die intensive literarische Gestaltung des Geschlechterkampfes. Hier knöpft sie sich jedoch auch staatliche Mythen vor. Shalevs eigener Vater war einst bei der Lechi. Von seinen Erzählungen wollte die Autorin – wie viele ihrer Generation – lange nichts hören. Ohne etwas zu beschönigen, rehabilitiert sie nun im Roman den Kampf der Lechi. Sie demontiert darüber hinaus Mutterbilder, Klischees von Frauen, zerreißt Illusionen vom familiären Zusammenhalt, möglichen bürgerlichen Komfortzonen, konterkariert das Selbstverständnis soldatischer Helden.
Und schildert überraschend unvoreingenommen Kraft und Halt, den der Glaube der Väter geben kann. Sanftheit und Gelassenheit derjenigen, die in Gott Zuflucht vor den Zumutungen des Lebens gefunden haben. Mit schmerzhafter Klarheit artikulieren sich in diesem Roman Stimmen derer, die bei aller Unterschiedlichkeit als Gemeinschaft verbunden sind.
frieden Shalevs Figuren stoßen an ihre Grenzen und müssen erfahren, dass sie tatsächlich nicht alles in der Hand haben. Der Titel Schicksal weist darauf hin. Man kann ihn als Fluch verstehen oder als Befreiung. Zeruya Shalev hat gute Argumente für beides. Aber sie eröffnet ihren Figuren schließlich heilsame Ausblicke, die Möglichkeit, vielleicht auf unkonventionelle Weise, gegen gesellschaftliche Erwartungen, geschichtliche Lehren und selbst auferlegte Bürden, neue Wege zu beschreiten und einem inneren Frieden näherzukommen.
Shalevs neues Buch ist ein großer israelischer Roman. Feinfühlig und kenntnisreich von Anne Birkenhauer ins Deutsche übertragen, erzeugt er in der Verbindung von Poesie, Spiritualität, historischem und psychoanalytischem Wissen, Herzensbildung und Klugheit einen unwiderstehlichen Sog.
Zeruya Shalev: »Schicksal«. Übersetzt von Anne Birkenhauer. Piper, München 2021, 416 S., 24 €