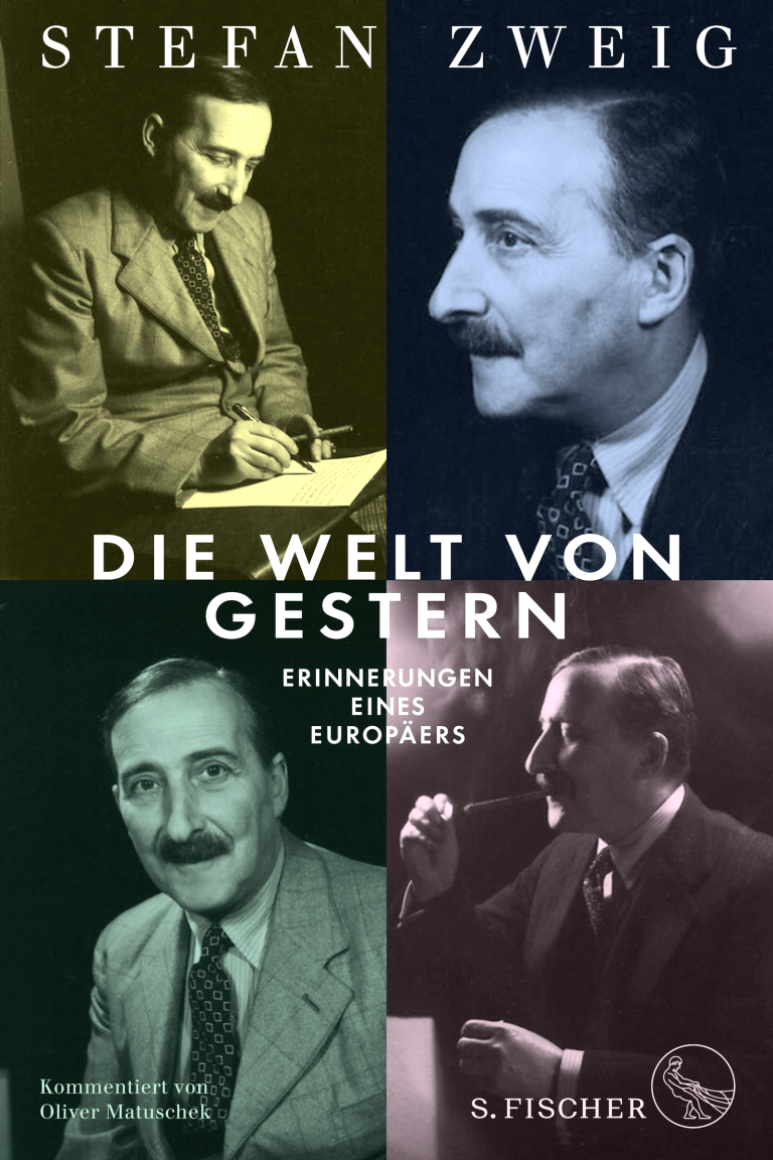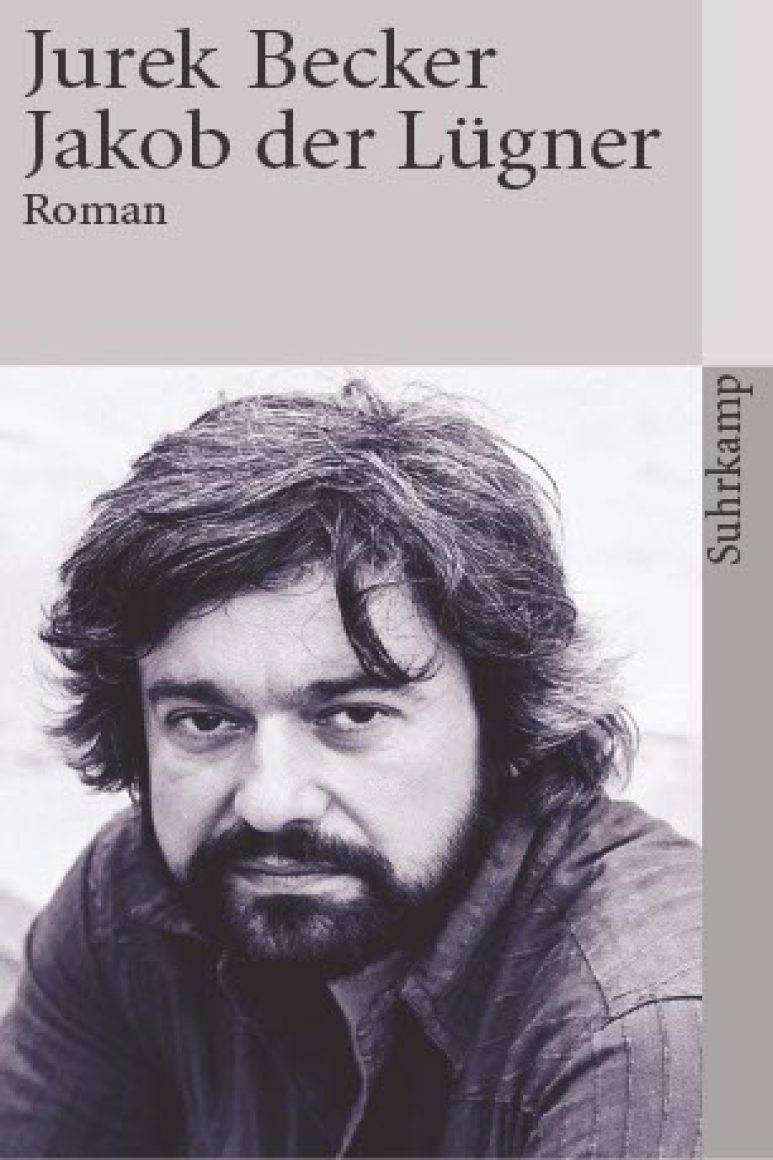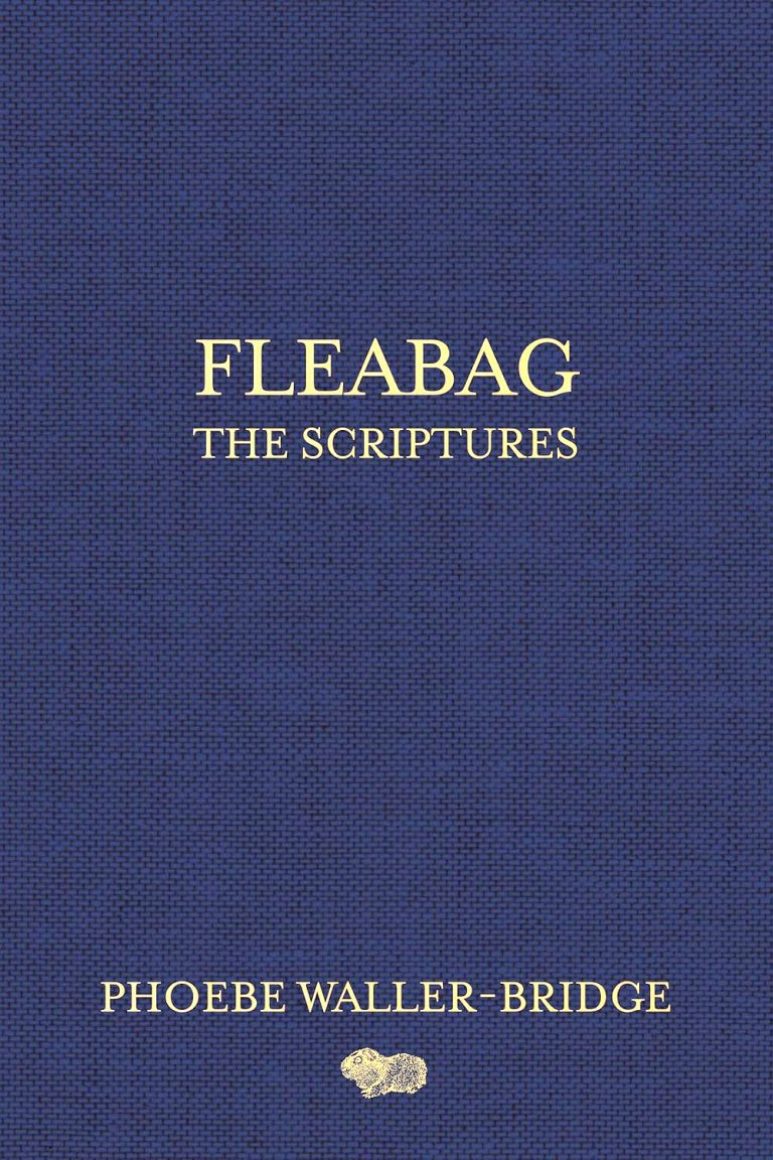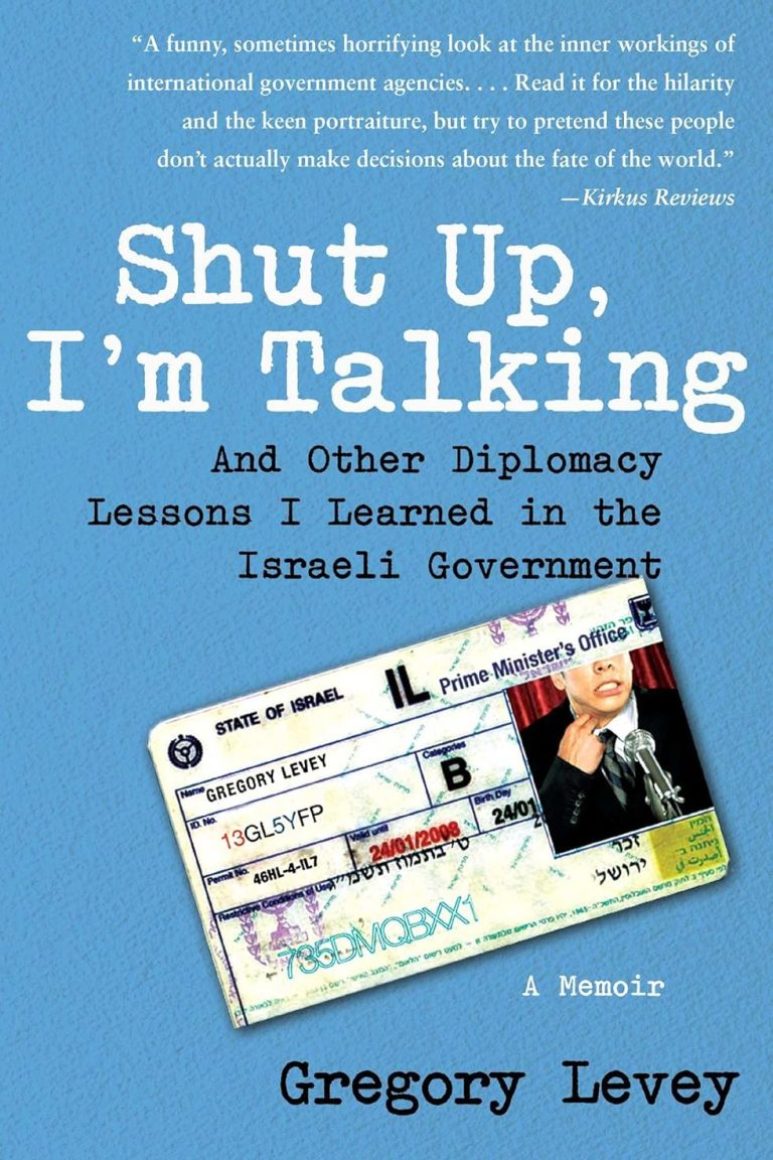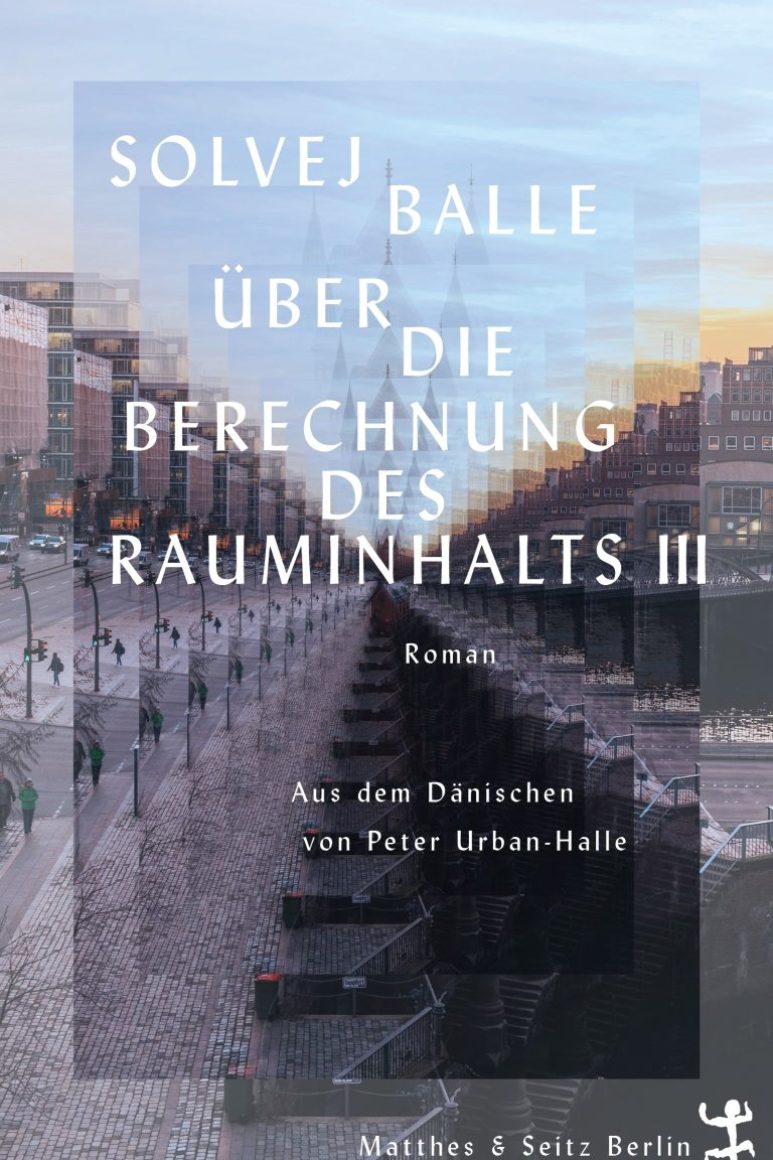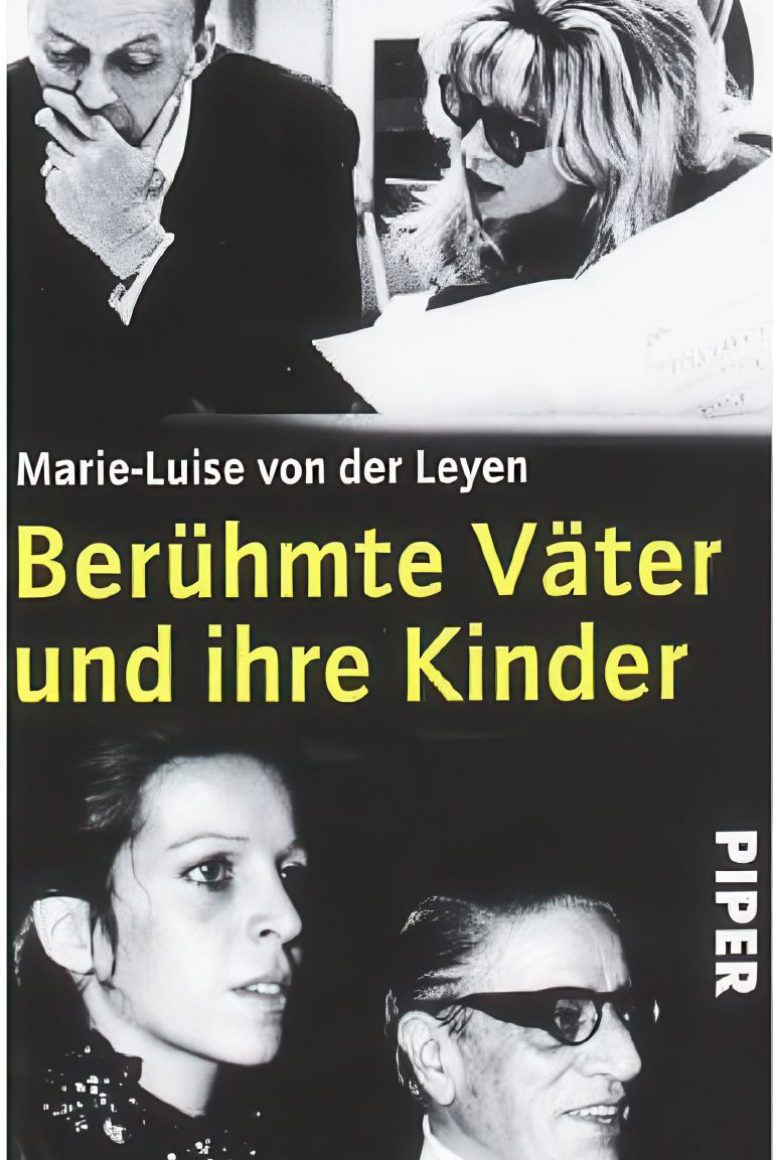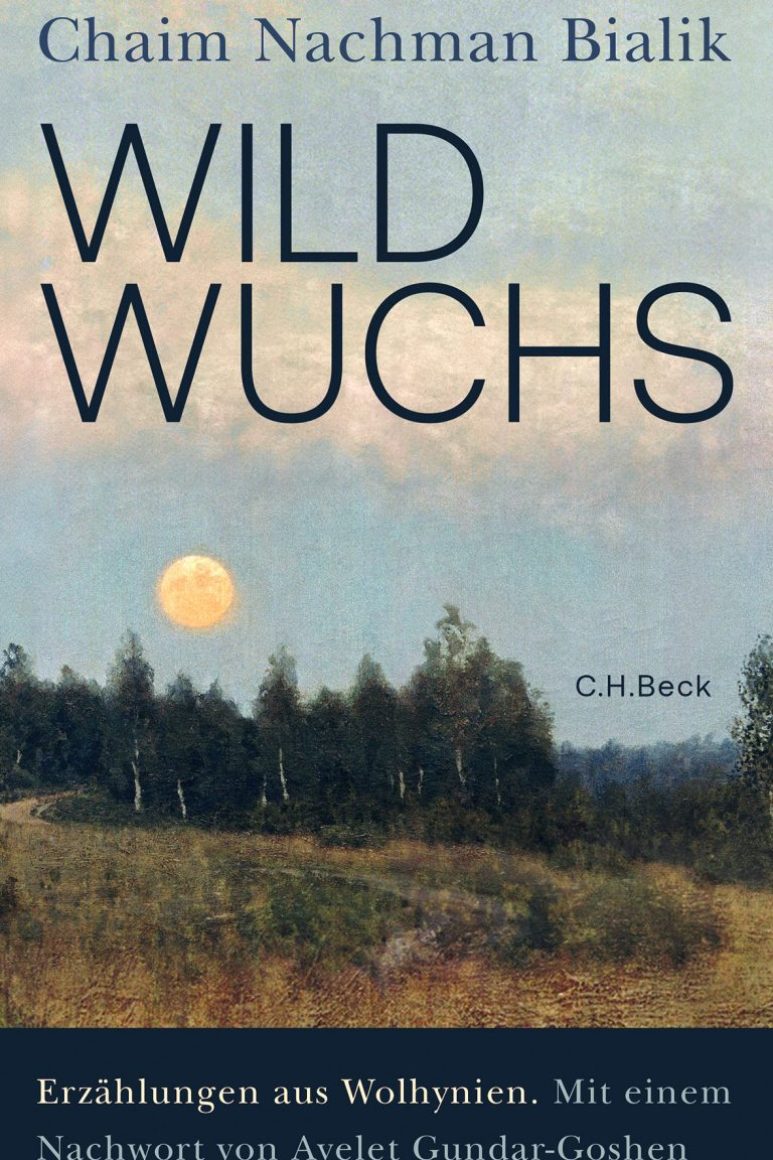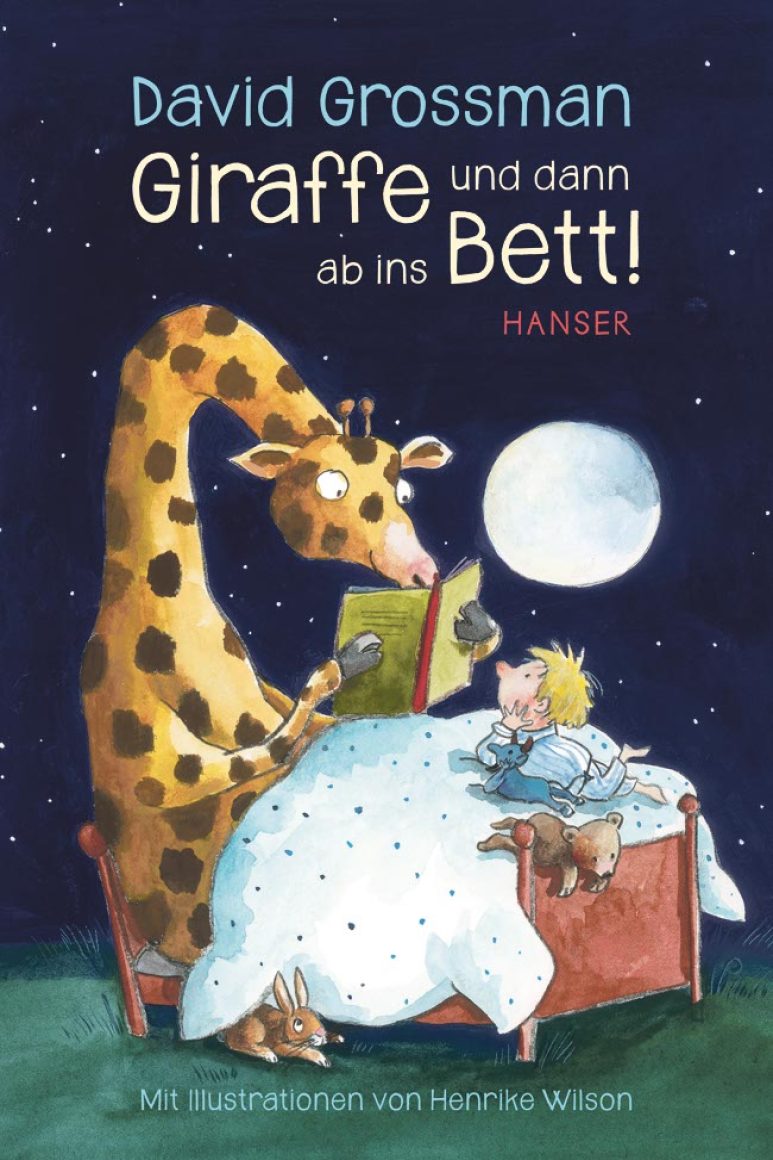»Die Welt von Gestern«
»Alles in unserer fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet. (…) Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle und an der höchsten der greise Kaiser. (…) Niemand glaubte an Kriege, an Revolutionen und Umstürze. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft.«
Wer im Urlaub eintauchen will in eine andere Zeit, ein anderes Europa, in ein anderes Wien, dem sei Stefan Zweigs Die Welt von Gestern ans Herz gelegt – ob am Strand, in den Bergen oder tatsächlich beim Schlendern durch Österreichs Hauptstadt. Zweig schreibt über ein Wien im »Goldenen Zeitalter der Sicherheit«: kultiviert, offen, geprägt vom Geist der Aufklärung, mit Kaffeehäusern als Lebensräumen, ein Wien der Bücher und des feinen Tons, ein Wien, das von Bildung zusammengehalten wurde. Doch dann wurde diese Stadt – und jene Zivilisation – unter den groben Händen der Geschichte zertrümmert.
Zweig verfasste Die Welt von Gestern nicht aus nostalgischer Verklärung, sondern mitten im Krieg, Anfang der 40er-Jahre, im brasilianischen Exil, als in Europa Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit – alles, woran er geglaubt hatte – untergingen.
Wer Wien heute besucht, wird die Stadt nach der Lektüre mit anderen Augen sehen. Aber Die Welt von Gestern ist weit mehr als eine Hommage an Wien, ein elegantes, zutiefst bewegendes Erinnerungsbuch und der Versuch, festzuhalten, was verloren ging. Es ist eine Warnung für die Gegenwart. Und eine Inspiration, über das fragile Glück des Friedens nachzudenken. Denn vielleicht leben auch wir aus der Sicht künftiger Generationen gerade in einer Welt von Gestern – die man eines Tages wehmütig vermissen wird. Tobias Kühn
Stefan Zweig: »Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers«. 46. Aufl. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2024 (Erstausgabe: 1942), 493 S., 17 €
***
»Jakob der Lügner«
Den ersten Roman von Jurek Becker entdeckte ich mit 16 im Haus meiner Eltern als Taschenbuch. Später habe ich Jakob der Lügner selbst gekauft. Antiquarisch, die DDR-Ausgabe des Aufbau-Verlags. Es steht kein anderes Buch in meinem Regal, das so zerfleddert ist. Auch diesen Sommer greife ich wieder zu dem Roman, der in den 40er-Jahren einem deutschen Ghetto in Polen spielt. Ich lese ihn, obwohl Becker statt eines »besseren« (oder heroischeren) Endes der Geschichte, das er kurz vor Schluss des 1969 in der DDR erschienenen Buchs anreißt, einem anderen Ausgang den Vorzug gegeben hat. Es ist »das blasswangige und verdrießliche, das wirkliche und einfallslose Ende, bei dem man leicht Lust bekommt zu der unsinnigen Frage: Wofür nur das alles?«
Falls das nicht nach einer Leseeinladung klingt, sollten Sie Jakob der Lügner trotzdem lesen. Und zwar wegen Beckers unvergleichlichem Humor, den ich als jüdisch bezeichnen würde, obwohl der Schriftsteller, der als Kind das Ghetto von Łódz überlebte, sich gegen »Zuschreibungen« gewehrt hat und nie als Autor von Holocaust-Literatur gelten wollte. Beckers heiter-melancholischer Tonfall, in dem auch von den kleinen Freuden der Menschen im Ghetto erzählt wird, ist ein Lesevergnügen von der ersten bis zur letzten Seite.
»Ich habe ein Radio!« Um zu erklären, woher er zufällig aufgeschnappte Informationen über den Vormarsch der russischen Armee hat, greift Jakob, ein alleinstehender älterer Mann, zu einer Lüge. Danach wird er so etwas wie der Hoffnungsbeauftragte des Ghettos. Jeden Tag löchern ihn Freunde, Nachbarn und völlig Unbekannte. Um sie nicht zu enttäuschen, erfindet der »Radiobesitzer« weitere Nachrichten von der Front. Bis die Lüge nicht mehr hilft. Was bleibt, ist die Geschichte von Jakob. Ayala Goldmann
Jurek Becker: »Jakob der Lügner.-Roman«. 39. Aufl., suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2023 (Erstausgabe 1969), 288 S., 1o €
***
»Fleabag: The Scriptures«
Vergessen Sie die großen Philosophen! Was wussten die schon über moderne Miseren wie vermaledeite Frisuren, durchgemachte Nächte, unglückliches Verliebtsein (okay, darüber wussten schon einige was, aber egal …). Vergessen Sie also alles, was Sie über Männer wie in Stein gemeißelt zu wissen glaubten, und lesen Sie Fleabag, The Scriptures.
Ihnen werden Sätze begegnen wie »Hair! is! everything!, Anthony!«, »I don’t think you have to be alone to be lonely« oder »I sometimes worry that I wouldn’t be such a feminist if I had bigger tits«. Diese wundervollen zeitgenössischen Äußerungen kommen aus der Feder der vielleicht lustigsten, zynischsten, verzweifelt-optimistischsten Autorin (und Schauspielerin) aus jüngster Zeit: Phoebe Waller-Bridge.
Die Britin, die ihre One-Woman-Show Fleabag 2013 zum ersten Mal beim Edinburgh Fringe Festival aufführte und die sich nach diesem riesigen Erfolg auch mit anderen Serien wie Killing Eve oder dem Skript zum James Bond-Film No Time to Die in den Drehbuch-Olymp eingeschrieben hat, begann mit kleineren Auftritten im Theater. Fleabag war ihr Durchbruch und wurde von Amazon in eine zweistaffelige Serie umgewandelt – mit Waller-Bridge in der Hauptrolle und Größen wie Olivia Colman als passiv-aggressiver Schwiegermutter und Andrew Scott als katholischem Priester und vielen anderen wundervollen Nebenrollen.
Vor mittlerweile sechs Jahren wurde das Drehbuch zu Fleabag: The Scriptures als Buch veröffentlicht, und es ist ein zeitloses philosophisches Durchblätterbuch. Zu sehen, wie die Szenen aufgebaut sind, welche Anmerkungen es gibt, und zu wissen, wie sie filmisch umgesetzt wurden, ist Yoga für den Kopf. Zwischendurch gibt es Lachen, Tränen, Biestigkeit, Liebe – ach, einfach alles. Lesen Sie es! Halten Sie es mit der Therapeutin in Fleabag, die sagt: »You already know what you’re going to do. Everybody does.« Katrin Richter
Phoebe Waller-Bridge: »Fleabag: The Scriptures«. Ballantine Books, New York 2019, 432 S., 27,99 €
***
»Shut up, Iʼm talking«
Bereits im Vorwort zeigt sich die ganze Absurdität seines Jobs. »Ich war 25 Jahre alt und noch nicht einmal israelischer Staatsbürger, aber durch eine bizarre Verkettung von Ereignissen saß ich allein auf dem Platz des Staates Israel in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wenige Minuten vor der Abstimmung über eine UN-Resolution«, schreibt Gregory Levey, ein kanadischer Jude südafrikanischer Herkunft. »Schlimmer noch. Ich hatte null Ahnung, wie Israel abstimmen wollte, und wusste nicht, worum es in der Abstimmung überhaupt ging.«
Das Beruhigende oder – abhängig von der Perspektive – Beunruhigende: Seine Vorgesetzten in der ständigen Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen waren gleichfalls nicht im Bilde. Dabei sollte Levey eigentlich nur ein paar Reden schreiben, die dort gehalten werden sollten, hieß es bei seiner Einstellung. »Entscheide selbst, was Israel dort sagen könnte«, lautete die Antwort auf seine Frage, was darin zur Sprache kommen sollte – so viel zum Thema diplomatische Professionalität.
Die Geschichte wird aber noch schräger, als er nach Israel versetzt wird, um Reden für Ministerpräsident Ariel Scharon zu schreiben. In Jerusalem sieht sich Levey mit Mitarbeitern der Regierung konfrontiert, deren Benehmen grenzwertig ist, wobei das Kauen und Ausspucken von gerösteten Sonnenblumenkernen, das öffentliche Schneiden von Fingernägeln bei Meetings oder ein äußerst rüder Umgangston noch das Harmloseste sind. Er selbst beginnt irgendwann, sich einen Spaß daraus zu machen, Referenzen aus dem TV-Klassiker Seinfeld in die Reden des Premiers einzuflechten. Leveys »Memorien«, wie er das Buch bezeichnet, sind ein kurzweiliges Dokument über die kulturellen Abgründe, die sich auftun können, wenn Diasporajuden und Israel aufeinandertreffen. Ralf Balke
Gregory Levey: »Shut Up, Iʼm Talking – And Other Diplomacy Lessons I Learned In The Israeli Government. A Memoir«. Free Press, New York 2010, 288 S., 17,99 €
***
»Über die Berechnung des Rauminhalts«
Und täglich grüßt das Murmeltier, möchte man sagen. Oder auch: Schon wieder Russian Doll? Aber tatsächlich ist Über die Berechnung des Rauminhalts eine ganz andere Spezies, was nicht nur daran liegt, dass es Literatur ist. In Solvej Balles Jahrhundertwerk – die dänische Autorin arbeitet an den sieben Bänden seit fast 40 Jahren, derzeit sitzt sie am sechsten – geht es nicht um den selbstverliebten Mann, der nur die richtige Frau finden muss, und auch nicht um die zugekokste New Yorker Feministin, die plötzlich ewig leben darf. Hier geht es um die fundamentale Größe selbst, die den Dingen im Raum ihre Richtung und damit Ordnung gibt und die das Leben zum Leben macht: die Zeit.
Aber keine Angst – was sich nach Isaac Newton und Schrödingers Katze anhört, ist die angenehm unaufgeregte Beobachtung einer aus den Fugen geratenen Welt mit den Augen und dem Hirn einer mittelalten Frau, die eigentlich mit Büchern handelt und mit ihrem Mann ein gemütliches Leben lebt. Das ändert sich am Morgen des 19. November, der sich als 18. November entpuppt, den Tara Selter eigentlich schon hinter sich hat. Aber im Hotel haben die Zeitungen die gleichen Schlagzeilen, und das Brot am Nachbartisch fällt im gleichen Bogen zu Boden wie am Vortag.
Von nun an ergründet sie jede der 1440 Minuten, die den einen Tag ausmachen, der ihr geblieben ist: Wie es sich anhört, wenn ihr Gatte diese ereignisarmen 24 Stunden erlebt, oder was das Wetter macht, wenn sie selbst durch weite Reisen versucht, sich Jahreszeiten nachzubauen. Das ist banal und existenziell zugleich. »Absolut unglaublich«, begeisterte sich Autorenkollege Karl Ove Knausgård. Auf Deutsch sind bisher die ersten drei Bände erschienen. Während des Wartens können die Leser am eigenen Leib erfahren, was Zeit bedeutet. Aber immerhin bewegt sich noch was. Sophie Albers Ben Chamo
Solvej Balle: »Über die Berechnung des Rauminhalts I.«. Matthes & Seitz, Berlin 2023, 170 S., 22 €
***
»Berühmte Väter und ihre Kinder«
Wie war Karl Marx eigentlich als Vater? Seine Tochter Tussy hätte wahrscheinlich zwei Antworten parat. Als Mädchen liebte sie ihren Vater so sehr, dass sie ihn in Zeiten seiner Abwesenheit überall suchte. Beide standen sich – auch intellektuell –- sehr nahe. Erst als Tussy eigene Wege gehen wollte, sollte sich das ändern. Der Philosoph erlaubte seiner Tochter nicht, ihre große Liebe zu heiraten. Und Tussy hatte zu Marxʼ Lebzeiten keine Chance, sich beruflich zu verwirklichen, und konnte »nur« als seine Sekretärin arbeiten. Trotz ihrer intensiven Verbundenheit zum Vater sah sie das äußerst kritisch.
So schildert es Marie-Luise von der Leyen in Berühmte Väter und ihre Kinder. Karl Marx, dessen Eltern aus Rabbinerfamilien stammten, hatte jung verheiratet zusammen mit seiner Frau aus Trier fliehen müssen und emigrierte nach England. Der selbst ernannte Weltverbesserer konnte mit Geld partout nicht umgehen, und so kam es, dass die Familie zeitweise in Londons Elendsquartieren leben musste. Nur drei von sieben Kindern erreichten das Erwachsenenalter. Tussy war die Jüngste.
Dieses und viele weitere Verhältnisse zwischen prominenten Vätern und ihren Kindern hat die Soziologin und Journalistin von der Leyen aufgegriffen. Sie bietet einen ungewöhnlichen und aufschlussreichen Blick auf die Vita von Politikern, Künstlern und anderen Persönlichkeiten wie Joseph P. und John F. Kennedy, Frank und Nancy Sinatra, Kaiser Franz Joseph von Österreich und Kronprinz Rudolf sowie Hermann und Franz Kafka.
Bei Kafka steht der berühmte Brief im Mittelpunkt, den er an seinen Vater geschrieben, aber nie abgeschickt hat. »Ich wäre glücklich gewesen, Dich als Freund zu haben«, hatte der Schriftsteller notiert. Denn als Vater dürfte er unerträglich für ihn gewesen sein. Der gewaltsame Versuch des geschäftstüchtigen Hermann Kafka, den Sohn nach seinem Vorbild zu formen, scheiterte. Franzʼ Bewusstsein der eigenen Nichtigkeit wurde zu seinem Lebensthema.
Die knapp 300 Seiten sind interessant geschrieben, vermitteln viel zeitgeschichtliches Wissen und erweitern die Kenntnisse über berühmte Persönlichkeiten und deren Gedanken und Gefühle. Am Ende der Lektüre wird sich jeder glücklich schätzen, keinen Kaiser, Philosophen oder prominenten Künstler zum Vater zu haben. Christine Schmitt
Marie-Luise von der Leyen: »Berühmte Väter und ihre Kinder«. Piper Taschenbuch, München 2011, 288 S., 12,99 €
***
»Wildwuchs – Erzählungen aus Wolhynien«
Vielleicht sollte ich für einen Sommerurlaub kein Buch empfehlen, das über Seiten hinweg detailliert den Pogrom von Kischinew schildert. Aber ich möchte es trotzdem tun. Denn Wildwuchs von Chaim Nachman Bialik fasziniert nicht nur mit dem ambivalenten Gedicht »In der Stadt des Tötens«, in dem ohnmächtiges Entsetzen über die Grausamkeit der Verbrechen ebenso anklingt wie antisemitisch anmutende Verachtung für die Opfer, sondern vor allem mit drei lebensklugen Erzählungen, inspiriert von Bialiks Kindheit in Wolhynien, der heutigen Westukraine.
Da ist die Geschichte »Die beschämte Trompete« über einen jüdischen Holzhändler, der in ein Dorf zieht, just einen Tag, nachdem es Juden verboten worden war, sich dort anzusiedeln. So wird er durch die Willkür zaristischer Bürokratie zu einem Verbrecher, aber »wenn es ums tägliche Auskommen geht, achtet man nicht auf Verbote und deren leidvolle Konsequenzen« – ein Satz, der für ihn ebenso gilt wie für die Machthaber im Ort. Und so blüht nicht nur die Korruption, sondern auch das jüdische Leben – bis die Bürokraten aus der Bezirksstadt genauer hinschauen.
Bialiks Protagonisten sind nicht nur Opfer, sondern Menschen mit Makeln. Wie der jüdische Junge in »Hinter dem Zaun«, der sich in das russische Nachbarsmädchen verliebt, aber garantiert nicht glücklich mit ihr zusammenleben wird bis ans Ende seines Lebens. Bialik schreibt mit unromantischem Blick über das Leben von Juden auf dem Land, aber in einer naturverliebten und vor Fantasie überbordenden Sprache. Wenn Sie diesen Sommer einen literarischen Ausflug aufs Land machen wollen, aber nicht nur auf Idylle aus sind, sondern auch etwas über Menschen lernen wollen, lesen Sie dieses Buch. Nils Kottmann
Chaim Nachman Bialik: »Wildwuchs. Erzählungen aus Wolhynien«. Mit einem Nachwort von Ayelet Gundar-Goshen. C.H. Beck, München 2025, 299 S., 26 €
***
»Giraffe und dann ab ins Bett!«
Wenn Opa Amos den kleinen Uri fragt, wo denn nur sein Autoschlüssel liege, und der Dreikäsehoch in seiner eigenen Sprache sagt: »Immt-iff-anne!«, weil er immer nur die letzten Silben ausspricht, beginnt die Suchaktion einer ganzen Familie. Übersetzer beziehungsweise Retter in der Not ist Uris großer Bruder Jonathan, der mit seinen fünf Jahren genau in der Mitte zwischen klein und schon-groß ist und beide versteht: die kleinen Kinder und die Großen. Und vielleicht steckt in Jonathan auch ein wenig von David Grossman, von dem nur diese, sondern auch andere wunderbare Erzählungen im Band Giraffe und dann ab ins Bett! stammen.
Denn Grossman, mittlerweile selbst Großvater, gelingt mit den Geschichten um Ruthi, Joram oder eben Uri genau das, was Erwachsene so oft verlernt haben: Übersetzer nach oben und nach unten zu sein, sozusagen Scharnier zwischen jener Welt, die sich Kinder oft ausdenken, und dem Alltag, den Mama und Papa –bei Grossman sehr oft der Papa –, zu bewältigen haben. Etwa, wenn die kleine Racheli mit ihrem Vater einen nächtlichen Spaziergang unternimmt, um zu schauen, wo ihre imaginäre Freundin Hadass wohnt.
Die 14 Geschichten des israelischen Schriftstellers beweisen sein Gespür für kindliche Bedürfnisse, Ängste und Träume. Ja, sie sind für den Moment vor dem Gute-Nacht-Sagen gedacht, aber sie haben so viel Witz und Wärme, dass man das Schlafen gerne noch eine Weile hinauszögern möchte. Nur der Papa von Ruthi findet, seine Tochter dürfe gerne den ganzen Tag und wieder die ganze Nacht und jeden weiteren Tag unter der Decke liegen bleiben, wenn sie keine Lust auf Kindergarten hat. Aber vielleicht verpasse sie dann das Großwerden? Das ist der Moment, in dem Ruthi aufsteht. In diesem Sinne »te türe!«, wie Uri sagen würde, mit diesem kleinen literarischen Juwel für Menschen ab dem Kindergartenalter. Nicole Dreyfus
David Grossman: »Giraffe und dann ab ins Bett!«. Carl Hanser, München 2018, 112 S., 15 €