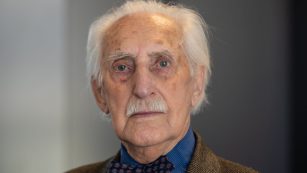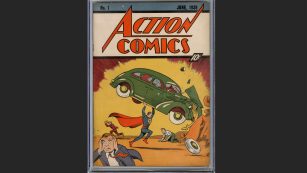Frau Funk, Ihr Buch »Nice to meet you, Tel Aviv!« ist eine Mischung aus Reiseführer und Tagebuch. Dass es erscheinen würde, war – nach dem 7. Oktober 2023 – zunächst nicht absehbar.
Alles war so gut wie fertig, der Text stand, die Bilder standen, die Reportagen waren fertig, ich hatte den ganzen Sommer 2023 daran gearbeitet, dann kam der 7. Oktober. Wir haben entschieden, dass ein Reiseführer – während dort ein Krieg wütet – nicht gepasst hätte.
Tel Aviv befindet sich im stetigen Wandel, irgendwann überholt sich ja sicher auch einiges, eine Herausforderung für so ein Buch?
Wer Tel Aviv kennt, weiß, wie schnell sich alles verändert. Läden, die heute offen sind, könnten morgen oder in einigen Wochen schon nicht mehr existieren. Alles ist schnelllebiger. Ich bin schon noch mal an einzelne Stellen rangegangen. Durch den Krieg sind natürlich einige Läden geschlossen worden.
Der Krieg, die Konflikte, auch das wird von Ihnen nicht ausgeklammert und thematisiert, wenn auch nur am Rande. In erster Linie ist es ein Buch, das Leser an die Hand nimmt und viele persönliche Betrachtungen, Anekdoten und praktische Tipps enthält.
Dieser Reiseführer ist eben auch ein Zeichen dafür, das Land über die politische Aufladung hinaus zu akzeptieren. Tel Aviv als Stadt zu betrachten, ohne die Projektionen. Tel Aviv ist eben nicht nur Religion. Oder Politik. Tel Aviv ist vor allem eine Heimat für Juden, Muslime, Drusen und Christen, für Beduinen, hier leben schwarze und weiße Menschen zusammen, und die schaffen einen kulturellen Reichtum, der wirklich alle Bereiche des Lebens durchdringt.
Ist es möglich, Israel ohne die Geschehnisse des 7. Oktober 2023 zu betrachten?
Hier kommt es darauf an, wen man fragt und wo diese Person ist. Für Juden ist der 7. Oktober eine Zeitenwende. Es gibt ein Davor und ein Danach. Das geht sicherlich nicht allen so. In Israel selbst spielt der 7. Oktober täglich eine Rolle, und gleichzeitig geht das Leben ganz normal weiter. Anders funktioniert es auch nicht. Für mich waren die Reaktionen in der ganzen Welt extrem augenöffnend. Man weiß jetzt genau, wer Freund und wer Feind ist. Ich finde das beruhigend.
Sie haben einmal gesagt, der perfekte Ort für Sie sei irgendwo in der Luft zwischen Israel und Berlin. Über viele Jahre sind Sie zwischen beiden Städten gependelt. Tel Aviv ist Ihr neuer Lebensmittelpunkt. Warum?
Diesen Schritt habe ich sehr bewusst getan. Die antisemitischen Reaktionen in der deutschen Gesellschaft sowie im Kulturbetrieb waren für mich nicht mehr lebenswert. Ich bekomme nach jedem Artikel, der von mir veröffentlicht wird, Morddrohungen. Die Angst, aus dem Haus zu gehen oder meine Tochter allein auf einen Spielplatz gehen zu lassen, war einfach zu groß. Dazu kommen noch weitere, weniger politische Gründe. Wir haben Alija gemacht. Meine Tochter geht jetzt in Tel Aviv zur Schule.
Richtet sich Ihr rund 200 Seiten starkes Buch eher an die jüdische oder an die nichtjüdische Community?
An beide Communitys. Eigentlich an alle, die Israel nicht so richtig kennen. In Deutschland haben wir zum Beispiel eine jüdische Community, die zu 90 Prozent aus Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion besteht. Viele von ihnen waren noch nie in Israel. Vielleicht ändert das Buch das.
Was sind die gängigsten Vorurteile über Israel hierzulande und umgekehrt?
Vorurteile gibt es auf beiden Seiten: Ganz viele denken, dass Israelis alle weiß sind, was natürlich völliger Quatsch ist. Über die Hälfte sind »People of Colour«. Umgekehrt glauben viele Israelis, dass alle Deutschen Israel supporten. Die muss ich dann immer aus ihrem Traumschloss holen.
Berlin gilt ja als Traumstadt für viele Israelis. Vorurteil oder Fakt? Statistiken zufolge bewegen sich zwischen 10.000 bis 30.000 Israelis allein in Berlin.
Es ist ein Klischee, dass in Berlin viele Israelis leben. Vielleicht sind es rund 8000. Aber die meisten, die vor zehn Jahren gekommen sind, sind dann irgendwann wieder zurückgegangen – zu Familie, ihren Freunden. Anfang der 10er-Jahre sind viele Israelis nach Berlin gezogen aufgrund der damaligen Preispolitik. Tel Aviv ist auch heute noch sehr teuer. Inzwischen sind Tel Aviv und Berlin aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis nahezu identisch. Wohnungen sind teuer, das Essen auch.
Israelis hierzulande äußern oftmals, wie ruhig, sauber und geordnet alles in Berlin verläuft. Wie betrachten Sie das, als gebürtige Berlinerin, die im Ostteil der Stadt aufgewachsen ist?
Tel Aviv ist eine sehr laute und lebhafte Stadt, sie befindet sich nun mal im Orient. Selbstverständlich ist Tel Aviv anders als jede europäische Stadt. Berlin ist leiser, ruhiger, zurückgenommener. Es gibt viele Israelis, die von der israelischen Mentalität angestrengt sind und Berlin als entspannter erleben. Aber in Berlin hat man dafür auch menschliche Kälte, Berliner sind zurückgenommener, die muss man erst einmal öffnen.
Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Unterschiede und die wesentlichen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Metropolen, die lange Zeit auch beide Ihr Lebensmittelpunkt waren?
Die tatsächliche und die soziale Kälte. In Berlin sind neun Monate Winter im Jahr, in Tel Aviv sind neun Monate Sommer. Berlin liegt nicht am Meer, es gibt viel weniger junge Menschen. Tel Aviv ist eine unglaublich junge Stadt, und sie ist viel kleiner. Ungefähr so groß wie Berlin-Mitte. Jeden Tag begegnet man jemandem, den man kennt.
Stichwort Gastfreundschaft. Woran mangelt es den Deutschen?
Mir fällt es schwer, das zu beurteilen, weil ich Berlinerin bin. Ich weiß gar nicht, wie das ist, als Tourist oder als Zugezogener. Wir Berliner sind vom Naturell her nicht sehr aufgeschlossen, aber wenn man uns gewinnt, dann ist es echt.
War Ihr Buch auch der Versuch, zwischen beiden Welten zu vermitteln?
Ich würde mich jetzt nicht als Brückenbauerin bezeichnen, ich wollte einfach ein authentisches Bild von Tel Aviv zeichnen. Es geht um einen authentischen Blick auf die Stadt, denn ich kenne Tel Aviv seit mittlerweile über 30 Jahren. Es ist mein subjektiver Blick auf die Stadt.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck von Israel 1991, als Kind, aus Ost-Berlin?
Ich war damals mit meinem Vater dort, nur anderthalb Jahre nach dem Mauerfall, und das ist für so ein Kind, das fast neun Jahre seines Lebens in einer sozialistischen Diktatur aufgewachsen ist, natürlich ein Schock. Israel war ja damals stark amerikanisiert. Und diese Mischung aus alten sozialistischen Idealen, aus dieser kalten und begrenzten Welt, in so eine orientalische Atmosphäre, das war natürlich beeindruckend.
Was hat diese so andere neue Welt in Ihnen ausgelöst?
Ich erinnere mich noch genau an meine einzelnen Familienmitglieder, an diese unglaubliche Herzlichkeit. Für mich war es eine wirklich große, sehr positive Erfahrung. Ich bekam einen Eindruck davon, was die Welt noch bedeuten kann, und das hat grundlegend mein gesamtes Verständnis – auch von mir selbst – geprägt.
Tel Aviv wurde zum prägenden Ort für Sie, später sind Sie eine Weile sogar gependelt.
Ich war dann noch einmal mit meinem Vater dort, ab meinem 18. Lebensjahr bin ich regelmäßig allein hin, es wurde immer mehr. 2014 zog ich für ein Jahr nach Tel Aviv, dann aus beruflichen Gründen zurück nach Berlin, danach bin ich gependelt. Ich kenne dieses Land und diese Stadt also sehr lange. Im Grunde habe ich zwei Heimatstädte. In Tel Aviv habe ich auch ein richtiges Sozialleben, ich habe dort Freunde, die ich seit 20 Jahren kenne.
Ein großer Schritt, nun ganz hinzuziehen, oder ein längst überfälliger?
Das Reisen kostet mich schon immer noch Kraft, aber für mich ist nun klar, dass ich in Berlin schon viele Jahre nicht mehr glücklich gewesen bin. Und in Tel Aviv bin ich glücklich! Wie das in 20 Jahren sein wird, kann ich noch nicht sagen. Aktuell fühle ich mich dort mehr zu Hause als in Berlin.
Das Buch ist in einem Plauderton geschrieben, man hat fast das Gefühl, Sie sitzen neben einem und erzählen.
Ich arbeite seit 15 Jahren als Autorin und habe einen eigenen Sound, den findet man in all meinen Texten, in meinen Kolumnen. Ich glaube auch, das ist einfach mein Ton. Es handelt sich also um einen personalisierten Reiseführer. Von Anfang an war klar, dass es meine persönliche Perspektive auf Tel Aviv sein soll.
Man erfährt auch einiges über Sie, zum Beispiel, dass Sie in der Berliner Klubszene waren. Wie verhält es sich mit den Klubs in Tel Aviv?
Israelis haben viel von ihrem Berliner Leben oder ihren Berliner Besuchen mit zurück nach Tel Aviv gebracht. Aber das ist natürlich auch der Globalisierung geschuldet. Jedes Gen-Z-Kid sieht heute gleich aus und hört auch die gleiche Musik. Ob in Paris, Berlin oder Tel Aviv. In den Tel Aviver Klubs wird aktuell viel harter 90er-Jahre-Techno gespielt, aber insbesondere Trance-Partys sind ein Riesending. Das am 7. Oktober 2023 angegriffene Nova-Festival war ein Trance-Festival.
Sie schreiben sehr offen über sich und thematisieren auch Ihr Alter. Was hat sich geändert, seitdem Sie die 40 überschritten haben?
Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich würde eigentlich sagen, dass sich so viel gar nicht verändert hat. Das liegt aber auch daran, dass ich vor einem Jahr ein völlig neues Leben begonnen habe, und das führt zu neuen Herausforderungen und Unsicherheiten. In ganz vielen Momenten fühle ich mich plötzlich wieder wie eine 24-Jährige, die sich fragt, wo sie in den nächsten Jahren stehen will.
Das rastlose Leben ist aber erst einmal vorbei?
Ich war schon nicht mehr rastlos mit 28. Aber jetzt gehe ich zum Beispiel in Tel Aviv wieder viel aus und bin häufig unterwegs. Auch, weil meine Tochter in einem Alter ist, in dem sie viel selbstständiger ist. Ich befinde mich seit einem Dreivierteljahr in einem neuen Leben, das hat weniger mit Alter zu tun. In dem Moment, in dem man aus geordneten Bahnen ausbricht, beginnt alles von vorn.
Was können wir von Israel lernen?
Alles an Israel ist sinnlich. Und Sinnlichkeit bedeutet, das Leben zu genießen. Das Hier und Jetzt. Unabhängig davon, was morgen sein wird. Tel Aviv ist ein gelebter Widerspruch. An der einen Ecke ein riesiger Wolkenkratzer, daneben direkt ein heruntergekommenes Haus. Es bedeutet, dass das Perfekte und Unperfekte nebeneinander und immer gleichzeitig existieren. Was das Land einem mitgibt, ist ein sehr gesunder Zugang zum Leben.
Sie beschreiben am Beispiel des historischen Efendi Hotels, das aus zwei alten Palästen besteht und vor vier Jahren von radikalen Palästinensern beschädigt und direkt wiederaufgebaut wurde, das Motto von Israel: Einfach weitermachen!
Von Israelis kann man den Mut zum Risiko lernen. Das haben die Deutschen einfach gar nicht. Und wenn man stagniert, stirbt man irgendwann. Das ist eine Gesellschaft, die es sich nicht leisten kann zu stagnieren. Es braucht einen existenziellen Druck von außen. Juden hatten es nie bequem, sie waren nie sicher, das führt zu einer speziellen Sicht auf das Leben.
Gefahr als ständige Begleiterscheinung – wie gehen Sie damit um?
Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Es kann einem ja die ganze Zeit etwas passieren. Aber das ist für mich nicht präsent. Meine Tochter geht allein zur Schule. Es gäbe gar keinen normalen Alltag, wenn man ständig nur Angst davor hat zu sterben. Dennoch kann man dem 7. Oktober in Tel Aviv nicht ausweichen: überall Graffitis von den Geiseln, Aufkleber der Ermordeten, gelbe Schleifen. Das ist natürlich speziell und auch nicht für jeden gut auszuhalten. Aber das ist Teil der israelischen Kultur. Das ist die jüdische Identität.
Gegen Ende des Buches gibt es noch Tipps für Tagesausflüge. Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort, ein Park in der Stadt oder lieber die Wüstenlandschaft?
Ich bin nicht so der Park-Typ. Ich liebe einfach den Strand!
Mit der Schriftstellerin sprach Alicia Rust.