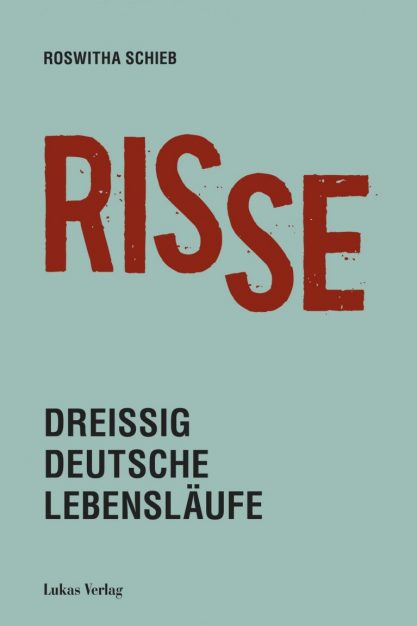Gab es das jenseits der gängigen Sonntagsreden wirklich – eine »deutsch-jüdische Symbiose«? Nicht zufällig nennt die Berliner Essayistin Roswitha Schieb ihr umfangreiches neues Buch Risse. Es versammelt, so der Untertitel, »dreißig deutsche Lebensläufe«; viele davon skizzieren das Leben deutscher Juden, die von einer deutschen Mehrheitskultur enttäuscht, wenn nicht gar ums Leben gebracht wurden. Manchmal reicht auch das schiere Vergessen – wie etwa im Fall der Schriftstellerin Fanny Lewald, deren Romane über Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert ungemein populär waren und sogar mit George Sand und George Eliot verglichen wurden. Und doch ist ihr Name heute höchstens noch Experten geläufig.
Begriffe Gemüt, Ehre, Treue; diese irgendwann aus der Hausapotheke deutscher Innerlichkeit entwendeten Begriffe, die spätestens seit der Nazizeit einen unheilvollen Beiklang haben – angesichts solcher Biografien bekommen sie noch einmal ihre ursprüngliche Bedeutung und Würde zurück. Gleichzeitig sind die Brüche nicht ungeschehen zu machen.
Else Ury etwa, die in der Weimarer Republik gefeierte Autorin der Nesthäkchen-Bücher, wurde im Alter von 66 Jahren nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. »Else Ury hatte es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Mädchen die deutsche Vergangenheit, deutsche Geistesgrößen und verschiedene deutsche Landstriche inklusive ihrer Dialekte nahezubringen.« Doch hat es ihr Leben nicht gerettet, dass sie in solch liebevoller Präzision in ihren Romanen berlinern und schwäbeln ließ und sich sogar an das Nordfriesische wagte.
KOSTÜMFEST Angesichts all dieser massenmörderisch verratenen Empathie stockt beim Lesen immer wieder der Atem – auch deshalb, weil die tiefe Zuneigung, mit der Roswitha Schieb schreibt, das rhetorische Akklamieren souverän verschmäht. Was ihr Buch überdies zu einem Augenöffner macht, ist die Verknüpfungskompetenz: So erinnert die Autorin angesichts jenes Nordfriesischen bei Else Ury an eine Passage in Günther Anders’ konzisem Erinnerungsbuch Besuch im Hades, die dem Andenken an Edith Stein gewidmet ist, jener zum Katholizismus konvertierten Philosophin, die 1942 in Auschwitz vergast wurde.
Anders beschreibt ein Kostümfest im Hause seines Vaters, eines Professors der Universität Breslau, zu dem sich im Jahr 1912 die damalige Studentin als Friesin verkleidet hatte, »um sich gewissermaßen für eine Nacht zu ›über-assimilieren‹«. Drei Jahrzehnte später die tödliche Travestie jenes Festes: Die Jüdin Edith Stein »im Habit der Karmeliterinnen, eingepfercht in einen Viehwagen, der mit tausend Anderen den Öfen entgegenfuhr«.
Was wäre aus der Bundesrepublik geworden, hätte man die Erfahrungen deutscher Juden wirklich ernst genommen?
Wo blieb, möchte man fragen, in all den Jahrzehnten danach ein humanes Entsetzen – jenseits von Gedenkreden und drittmittelgeförderten akademischen »Projekten«? Wo zum Beispiel bleibt, bei aller längst inflationären Beschäftigung mit Anne Frank, die Erinnerung an Selma Meerbaum-Eisinger, die mit 18 Jahren im Lager Michailowka in der Ukraine ermordet wurde und die zuvor der deutschen Sprache so wunderbare Gedichte wie dieses geschenkt hatte: »Tragik./ Das ist das Schwerste: sich verschenken/ und wissen, daß man überflüssig ist,/ sich ganz zu geben und zu denken,/ daß man wie Rauch ins Nichts verfliegt.«
PERFIDIE Im Kapitel über Walter Benjamin wird dagegen an eine Perfidie erinnert, die der deutschen Nachkriegsleserschaft wahrscheinlich als solche nie kenntlich wurde: Der sich als links verstehende bundesdeutsche Erfolgsautor Alfred Andersch – ehemaliger Wehrmachtssoldat mit reichlich mystifizierter Desertationsgeschichte – schreibt ein Gedicht auf Benjamin, das es in wenigen Zeilen fertigbringt, die Tragik des in Portbou zu Tode Gehetzten kaltherzig misszuverstehen und dazu noch mit einer Prise Antiamerikanismus zu garnieren: »an der spanischen grenze wußten Sie/ daß Ihre zeit zu ende war// jenseits des meeres gab es nur noch/ das Institut// die zensierten texte/ die abgelehnten dissertationen/ wie damals/ in frankfurt// das war kein ziel für Sie, Benjamin /(…) weicher bürgerlicher berliner jude/ lenin erwartend und/ den heiligen geist«.
Was wäre aus der Bundesrepublik geworden, sinniert Roswitha Schieb, hätte sie die Erfahrungen deutscher Juden wirklich ernst genommen und auf diesem Weg etwas so Wertvolles wie Ambivalenzbewusstsein gelernt?
Was etwa, wenn der Schriftsteller und liberale Antikommunist Hans Sahl bei seiner ersten gescheiterten Rückkehr nach Deutschland von der selbstgerechten Literaten-»Gruppe 47« nicht weggebissen oder ignoriert worden wäre? »Vermutlich hätten sich die ideologischen Grabenkämpfe im Gefolge der 68er-Bewegung in den 1970er- und 1980er- Jahren als nicht so verbissen und langlebig erwiesen, hätte jemand wie Hans Sahl das bundesdeutsche Nachkriegskulturleben durch gewaltfreie, freundlich-ironische Humanität bereichern können.«
Zu spät. Umso wichtiger dieses aufwühlende und gleichzeitig präzis analysierende Buch des Aufbewahrens und Gewichtens, in dem die Aufforderung zum Erinnern in keiner Zeile zur Leerformel erstarrt.
Roswitha Schieb: »Risse. Dreißig deutsche Lebensläufe«. Lukas, Berlin 2019, 303 S., 24,90 €