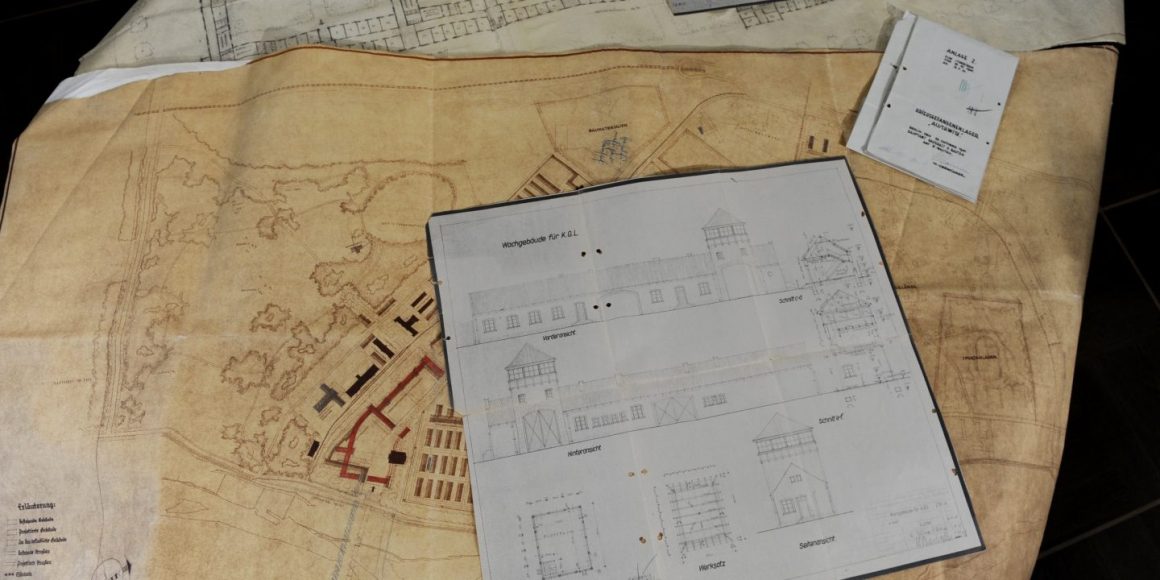Es macht einen großen Unterschied, ob man eine historische Quelle liest oder vorgelesen bekommt. Das Institut für Zeitgeschichte in München brachte in seiner Edition »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland« gemeinsam mit dem Bundesarchiv und den Universitäten in Freiburg und Berlin seit 2008 über 5000 Dokumente zum Holocaust heraus. Sie verschlagen einem schon in dieser Fassung den Atem.
Trotzdem ist die Wirkung der Hörfassung noch einmal wesentlich intensiver. Diese Fassung fertigt der Bayerische Rundfunk seit 2013 an und schloss sie nun mit der Vertonung einer Auswahl der Quellen des 16. Bandes »Das KZ Auschwitz 1942-1945 und die Zeit der Todesmärsche 1944/45« ab.
Suchbewegung Die Wirkung liegt an der menschlichen Stimme und auch am Format: »Man kann sich dem Geschehen in der Audiofassung nicht so leicht entziehen wie bei einem Text«, sagt Katarina Agathos, die das Projekt vonseiten der Redaktion betreute, lange gemeinsam mit Herbert Kapfer. »Eine Edition in Buchform rezipiert man in der Regel in einer Art Suchbewegung. Man liest quer, blättert und springt, wenn man den Inhalt erfasst zu haben meint, und lässt den Inhalt nicht ganz so nah an sich ran.«
Bei einem Hörstück hängt man mit drin. Und es geht immer weiter: ob nun in den anderthalbstündigen Radio-Versionen der einzelnen Bände, von denen jetzt auch die letzten Teile in der ARD-Audiothek stehen, oder auf der Internetseite des Projekts. Diese ist ein Ereignis für sich und soll demnächst für den Smartphone-Gebrauch optimiert werden.
Dort lassen sich alle seit 2013 vertonten Dokumente einzeln im Audio- und Textformat ansteuern. Aber man kann sich auch hier jeden der 16 Teile im Ganzen anhören. Eine Autoplay-Funktion sorgt dafür, dass sich ein Dokument über das NS-Verbrechen ans andere reiht.
Minimalistisch Hinzu kommen ausführliche Gespräche, etwa mit der Historikerin Andrea Rudorff, die für den 16. Band der wissenschaftlichen Sammlung zuständig war, oder einige Karten, die genauso minimalistisch wie das gesamte Portal daherkommen. Zur Sammlung gehören auch Interviews mit Zeitzeugen, deren Stimmen einzelnen Dokumenten der Edition, die nicht von Schauspielern gelesen werden, eine ganz eigene Note verleihen.
Agathos bezeichnet die Zeitzeugen-Stimmen des Projektes als »eine Brücke in die Gegenwart«. Es braucht sie allerdings auch, muss man hinzufügen, um etwas Abwechslung in den sehr sachlichen, auf Geräusche, Musik und anderes Material verzichtenden Sound des Projekts zu bringen. Nüchtern ist der Ton der Schauspieler, die das Einsprechen der Dokumente seit 2013 besorgten, von Bibiana Beglau und Matthias Brandt bis zu Wiebke Puls und Michael Rotschopf.
Insgesamt ist seit Beginn des Langzeitprojektes etwa ein Zehntel der fünftausend Dokumente der gedruckten Edition vertont worden, thematisch wie in der Vorlage sortiert nach Ländern und dabei chronologisch aufsteigend. Auf der Homepage des Projektes, die jetzt noch englische Übersetzungen der Texte erhalten wird, liegen damit einschließlich des Zusatzmaterials über hundert Stunden Audiomaterial - beeindruckend klar und schlicht aufgemacht.
Lernmaterial In den vergangenen Jahren hatte die Website im Schnitt 35.000 Besucher im Monat, dreiviertel davon aus Deutschland. Das ist nicht wenig und könnte doch mit etwas Werbung sicherlich verbessert werden. Für jeden Geschichtskurs, der nach interaktivem Lernmaterial für die Oberstufe sucht, ist diese Homepage ein Gewinn. Und als an Geschichte interessierter Erwachsener meint man zwar schon viel zum Thema zu wissen - aber beim Hören kommt es einem vor, als hätte man es sich mit diesem vermeintlich umfassenden Wissen vor langem zu bequem gemacht.
»Die Quellen sprechen« dokumentiert auf imposante Weise die Verbrechen, die das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1933 und 1945 beging. Das Projekt besticht durch das Nebeneinander verschiedenster Quellentypen und den Wechsel von Täter- und Opfer-Perspektiven, und hilft nicht zuletzt über die Befürchtung hinweg, dass sich die Geschichte des Holocaust nach dem Tod der Zeitzeugengeneration nur noch schwierig vermitteln ließe.