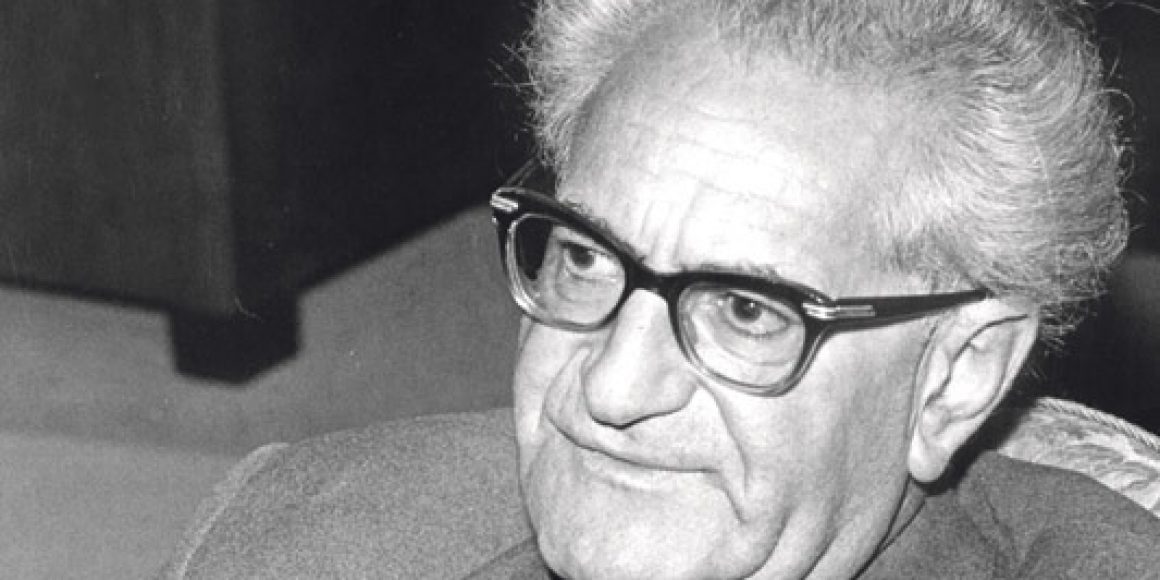»Gute Frage«, hatte der Dozent gesagt. Reut Paz erinnert sich, wie sie als Studentin in einem Seminar an der juristischen Fakultät der Universität Helsinki neugierig wurde: »Warum sind so viele bedeutende deutschsprachige Völkerrechtler jüdischer Herkunft?« Die Frage wurde zur Aufgabe – Paz promovierte beim Seminarleiter – und zum Schwerpunkt einer von ihr organisierten Tagung, die vergangene Woche in Berlin stattfand. Die anwesenden Wissenschaftler versuchten herauszufinden, ob und wie die jüdische Identität eines Hans Kelsen, eines Georg Jellinek oder eines Hersch Lauterpacht deren Denken über Krieg und Frieden, die Rolle des Staates oder den Schutz der Menschenrechte beeinflusst hat. Unter die Lupe genommen wurden sowohl Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als auch »Praktiker« der Nachkriegszeit, die zur Institutionalisierung der Vereinten Nationen oder der internationalen Gerichtsbarkeit maßgeblich beigetragen haben.
Die Schwierigkeit des Unterfangens wurde sofort klar. Reut Paz erwähnte in ihrem Eröffnungsvortrag die antisemitische Haltung von Juristen wie Carl Schmitt, die in der Nazizeit eine »jüdische Rechtswissenschaft« an biologisch-rassistischen Kriterien festmachten. So brachte auch der Rechtshistoriker Michael Stolleis sein Unbehagen zum Ausdruck, als er über Erich Kaufmann referierte. Kaufmann, später Berater im Auswärtigen Amt, war evangelisch getauft. Dennoch wurde er wegen seiner jüdischen Vorfahren ins Exil nach Holland gezwungen. »Übernehmen wir nicht die Kategorien der Nazis, wenn wir aus ihm einen Juden machen?«, fragte Stolleis skeptisch. Und warum überhaupt Spuren der jüdischen Identität suchen bei Autoren, die sich selbst als Agnostiker definierten oder sich gar nicht zum Judentum äußerten?
Diaspora Während einige Teilnehmer einer klaren Antwort auswichen, versuchten andere, die Theorie des Völkerrechts so zu kontextualisieren, dass es darin Platz für Kultur und Identität geben dürfe. Der Verfassungsrechtler Ulrich K. Preuß erwähnte die Spannungen zwischen den nationalen Minderheiten in Mitteleuropa, die sich vor den Augen vieler Völkerrechtler abspielten: für Preuß ein entscheidender Motor in der Entwicklung ihrer Reflexion über Nationen, Grenzen und Staatlichkeit. Laut Reut Paz sei eine im Judentum verwurzelte Haltung mindestens ebenso wichtig gewesen: »Sie glaubten alle an das Gesetz.« Mit der Diaspora-Erfahrung könne man sich außerdem eine vereinte Welt besser vorstellen: »Sie waren bessere Kosmopoliten«, meinte Paz.
Auf soziologischer Ebene sind weitere Gemeinsamkeiten erkennbar: Die Emigration wurde für die in einem elitären System ausgebildeten Akademiker zur Lebensprobe, bot jedoch auch Chancen. Hersch Lauterpacht, Eric Stein oder Fritz Bauer gelangten später wieder an die Spitze ihrer Disziplin. Es lag weder an einem vermeintlichen Geschick für Netzwerkpflege noch an überdurchschnittlicher Intelligenz – »weitere Vorurteile«, so Paz: »Sie mussten einfach überleben.« Nach 1945 hätten die jüdischen Juristen außerdem die Dringlichkeit zur Erneuerung des Völkerrechts und der Ausbildung von Experten gesehen.
Vielfalt Trotz dieser Gemeinsamkeiten hätten die Rechtswissenschaftler ein unterschiedliches Verhältnis zum Judentum und zu Israel gehabt. Isaac Breuer sprach 1946 im Namen der Orthodoxie vor den Vereinten Nationen, während Lauterpacht die Gründung des Staates Israel unterstützte. Marie Munk half ehemaligen Emigranten bei ihren Restitutionsersuchen und Fritz Bauer bei der strafrechtlichen Verfolgung früherer Nazis. Eric Stein befasste sich seinerzeit mit der deutschen Gesetzgebung zum Verbot der Holocaustleugnung.
»Man sollte immer die Vielfalt der jüdischen Identitäten berücksichtigen«, schlug ein Teilnehmer aus dem Publikum vor. Reut Paz war derselben Meinung: Es sei der einzige Weg, der Komplexität des Themas gerecht zu werden und dabei Tabus wie Klischees zu vermeiden.