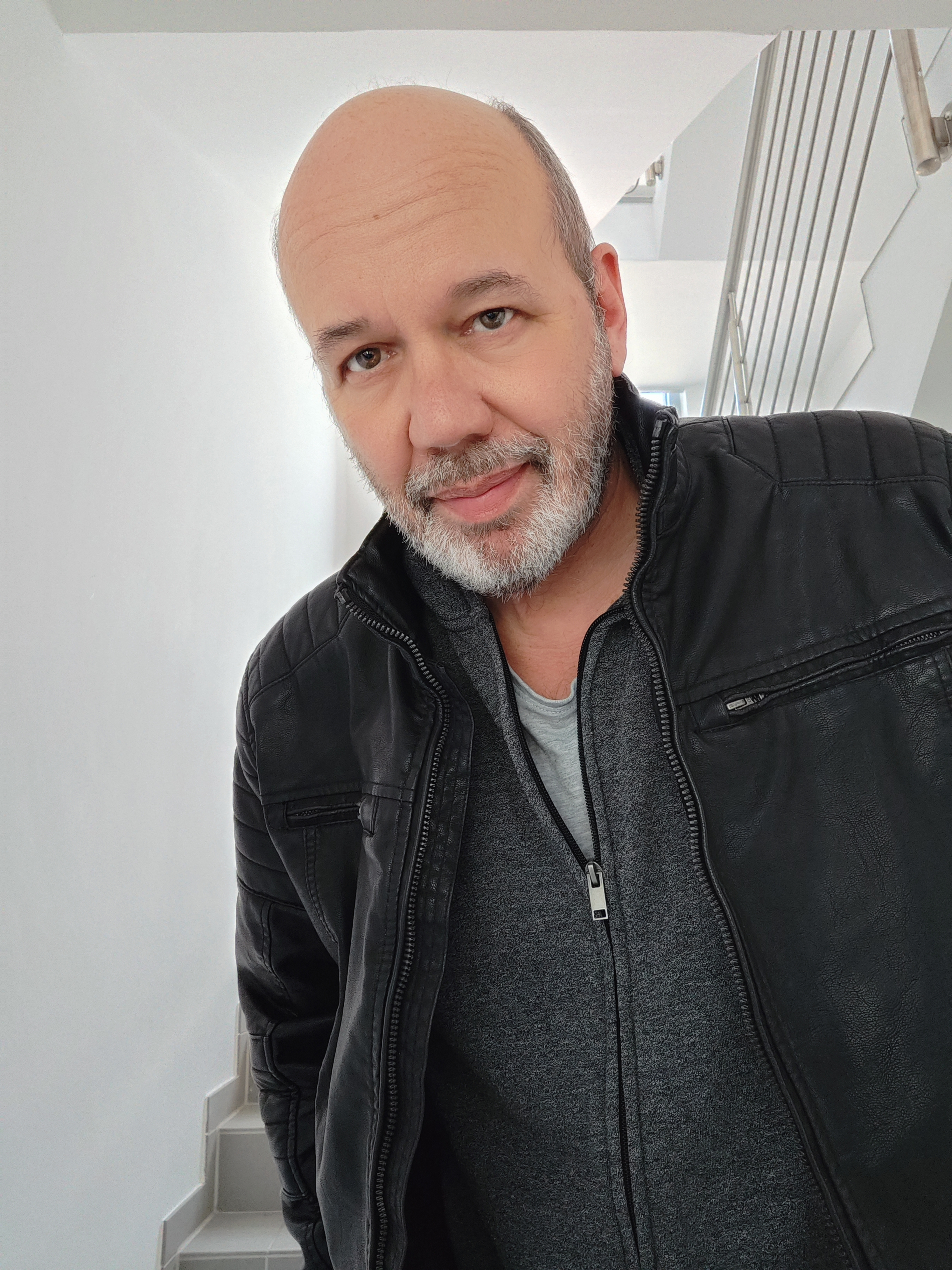»LIKRAT – Lass uns reden!«, ein Dialogprojekt, das junge Nichtjuden mit gleichaltrigen Juden zusammenbringt, ist der Gewinner des Simon-Wiesenthal-Preises. Das Programm, das mit dem Projekt »Meet a Jew« vom Zentralrat der Juden in Deutschland vergleichbar ist, wurde am Dienstagabend im Wiener Parlament mit der Ehrung bedacht. Ausgezeichnet wurde sowohl die österreichische, als auch die schweizerische Version von LIKRAT.
Übergeben wurde der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die Juryvorsitzende Katharina von Schnurbein. Die Deutsche ist seit neun Jahren Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission.
Mit seinen Treffen für Jugendliche will LIKRAT antisemitische Vorurteile bekämpfen und ein pluralistisches Bewusstsein generieren. In Österreich und der Schweiz leben jeweils nur etwa 15.000 Juden. Viele nichtjüdische Schüler haben daher noch nie Juden getroffen.
Trauriger Höhepunkt
Bei Zusammenkünften dieser Art stellt sich in der Regel heraus, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Auf diese Weise können sich Stereotype und Judenhass schnell auflösen. Die Teilnehmer fungieren außerdem oft als Multiplikatoren, die ihren Freunden und Familien von der Begegnung erzählen. So wird eine Streuwirkung erzielt.
Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) erklärte nach der Preisverleihung an das von der jüdischen Dachorganisation betriebene LIKRAT-Projekt: »Für den SIG ist dieser Preis eine große Ehre, der auch die Arbeit des Verbandes im Kampf gegen den Antisemitismus in der Schweiz würdigt.«
»Die Auszeichnung mit dem Simon-Wiesenthal-Preis setzt ein starkes Zeichen in einer Zeit, die auch in der Schweiz von einer besorgniserregenden Zunahme an antisemitischen Vorfällen geprägt ist. Trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung war der brutale Messerangriff auf ein jüdisches Gemeindemitglied in Zürich vor wenigen Tagen.«
Grenzübergreifende Zusammenarbeit
SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner sprach in seiner Dankesrede von der Bedeutung, die LIKRAT in der Schweiz habe. Er betonte den Wert der grenzübergreifenden Zusammenarbeit: »Gerade in der momentan schwierigen Zeit, seit dem 7. Oktober 2023, ist ein Präventionsprojekt wie LIKRAT wichtig, um gegen den grassierenden Antisemitismus ein Signal zu setzen. Dies auch mit starken Partnern wie LIKRAT Österreich«.
Der Austausch, auch mit den Schwesterprojekten »Meet a Jew« Deutschland und LIKRAT Moldova, gebe allen Beteiligten wertvolle Impulse, sagte Kreutner.
LIKRAT wurde vom Literaturwissenschaftler Alfred Bodenheimer und dem Anwalt und Finanzexperten Josef Bollag im Jahr 2001 in der Schweiz gegründet. Laut SIG ist das Projekt in den letzten Jahren stetig gewachsen und konnte daher auch ins Ausland ausgeweitet werden.
Auch in der Schweiz verbreitet sich der Judenhass. Dies zeigte sich Anfang des Monats, als ein Jude in Zürich von einem muslimischen Angreifer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Am Dienstag legte der SIG seinen Jahresbericht für 2023 vor, der das erschreckende Ausmaß antisemitischer Vorfälle in der Schweiz offenbart.
Ignorierte Anfeindungen
Neben dem Hauptpreis wurden weitere Ehrungen vergeben, die ebenfalls zum Simon-Wiesenthal-Preis gehören, darunter der Preis für zivilgesellschaftliches Engagement. Er ging an die spanische Initiative Asociación Cultural Mota de Judíos.
Letzteres Projekt wurde in dem Dorf Castrillo Matajudios in der Provinz Burgos innerhalb der autonomen Gemeinschaft von Kastilien und León gegründet. Die Übersetzung des Dorfnamens lautet in etwa »Ort, an dem Juden getötet werden«.
Aufgrund des offensichtlich judenfeindlichen Namens, beschlossen die Dorfbewohner im Jahr 2015, ihr Zuhause umzubenennen. Es heißt seither wieder Castrillo Mota de Judíos (»Ort der Juden«), wie dies vor dem Jahr 1632 der Fall war. Die Initiative der Bewohner ignorierte Anfeindungen, die es wegen des Namenswechsels gab und setzten diesen um.
Jüdische Lebenswelten
Auch CENTROPA aus Österreich erhielt einen der Preise. Laut einer Erklärung des Parlamentes in Wien dokumentiert diese Organisation die Erinnerung von Zeitzeugen. Hier geht es sowohl um den Holocaust als auch um »jüdische Lebenswelten vor dem Zweiten Weltkrieg«. Konkret wurde CENTROPA jedoch um seine Bemühungen ausgezeichnet, Bildung zum Holocaust in der Ukraine trotz des andauernden Eroberungskrieges Russlands fortzusetzen.
Auch wurden die folgenden Zeitzeugen jeweils direkt mit dem Simon-Wiesenthal-Preis bedacht: Helga Feldner-Busztin und Jeno Friedman aus den Vereinigten Staaten, Octavian Fülöp aus Rumänien, Naftali Fürst und Otto Nagler aus Israel, Maria Gabrielsen aus Norwegen, Viktor Klein, Katharina Sasso und Liese Scheiderbauer aus Österreich sowie Marian Turski aus Polen. In all diesen Fällen erfolgte die Ehrung für Beiträge zur Antisemitismus-Prävention.
Letztes Jahr wurde die israelische Initiative Zikaron BaSalon mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnet.
Der Preis selbst erinnert an den Architekten, Publizisten und Schriftsteller Simon Wiesenthal (1908-2005), der auch als »Nazijäger« bekannt war. Vergeben wird er vom »Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus«.