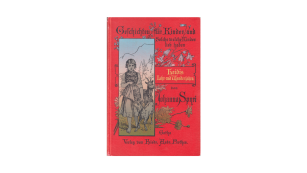In einem Wiener Wirtshaus fließt der Alkohol in Strömen, es klirren die Gläser, und das Gespräch fällt wieder einmal auf die Juden. Rat Bernart, der Abgeordnete der Großdeutschen und ein kugelrunder Mann mit fedrigem Schnauzer, legt los: »Ich behaupte, dass die Juden an all unserem Elend schuld sind.« – »Warum ausgerechnet die Juden?«, fragt ein anderer Gast. – »Das werden Sie sehen, wenn sie weg sind.«
Was der Antisemit Bernart androht, wird bald traurige Wirklichkeit: Man vertreibt die Juden aus der Hauptstadt. In Eisenbahnwaggons müssen sie in andere europäische Großstädte emigrieren: London, Genf, Berlin. In einer beispiellosen, staatlich organisierten Aktion verlieren die Wiener Juden ihre Heimat, die bald darauf geistig und wirtschaftlich verkümmert.
Hans Moser Es ist eine Stummfilmszene in Schwarz-Weiß aus dem Jahr 1924, und der damals noch keinem breiten Publikum bekannte Hans Moser spielt den Rat Bernart. Der österreichische Stummfilm Die Stadt ohne Juden drückt beinahe prophetisch aus, was wenige Jahre später in noch viel schlimmerer Form Realität werden sollte: die Vernichtung der Juden.
Der Film (Regie: Hans Karl Breslauer) ist für Nikolaus Wostry, den Sammlungsleiter des Filmarchivs Austria, ein bedeutendes »antifaschistisches Manifest«. Er geht auf einen Roman des Satirikers und Schriftstellers Hugo Bettauer zurück. Dessen Leben endete tragisch: Er wurde ein Jahr nach Erscheinen des Films von einem Nationalsozialisten erschossen. Seine kritische publizistische Tätigkeit, in der er Doppelmoral, den Einfluss der Kirche und die Mächtigen anprangerte, war Großdeutschen wie Konservativen ein Dorn im Auge.
Die Stadt ohne Juden blieb indes verschwunden, bis 1991 eine Kopie in einem Amsterdamer Filmmuseum auftauchte. Der Fund dieses bedeutenden Stummfilms war eine Sensation, erzählt Wostry, wenngleich auch das Ende und mehrere Szenen fehlten, was textliche Überleitungen erforderlich machte.
Flohmarkt Nun haben die Filmarchivare eine neue Sensation zu vermelden. Eine zweite Fassung wurde Ende 2015 auf einem Pariser Flohmarkt entdeckt. Das Filmarchiv Austria erwarb das Nitromaterial. Nikolaus Wostry gerät ins Schwärmen, wenn er von der neuen, der Pariser Fassung erzählt. Sie sei »deutlich besser« als die Amsterdamer Version. Der Grund: In der Amsterdamer Fassung fehlen viele explosive Szenen. In den 20er-Jahren bereits dürften Kinobesitzer mit der Schere an die Filmrollen gegangen sein, um den Inhalt zu glätten.
Die Pariser Fassung beinhaltet also Szenen von Übergriffen und Vertreibung: der Antisemitismus von unten. Im alten Film wird die Vertreibung der Juden als Entscheidung der Regierung dargestellt, das gesellschaftliche Moment fehlt. Aber auch Innenansichten des jüdischen Lebens der 20er-Jahre, etwa Szenen in einer Synagoge, sind neu. Für Wostry sind sie als Zeitdokumente wichtig, da aus dieser Zeit kaum Filmmaterial erhalten geblieben ist. »Der Film hat in dieser Weise nicht existiert«, sagt der Sammlungsleiter. Die Neufassung sei »viel jüdischer und politischer«.
Digitalisierung Das Nitromaterial ist alt und porös, Reparatur und Digitalisierung sind teuer. Aus dem laufenden Budget des Filmarchiv Austria können diese Mehrkosten nicht bezahlt werden. Von öffentlichen Fördergebern erhielt man Absagen.
Also entschloss sich der Direktor des Filmarchivs, Ernst Kieninger, zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Die Filmrettung wurde zu einem Crowdfunding-Projekt auf der österreichischen Plattform »We Make It«. Private Sponsoren sind aufgerufen, Geldbeiträge zu spenden. Die Kampagne verlaufe »sehr erfreulich«, sagt Kieninger. Rund 55.000 Euro von insgesamt 75.500 Euro sind bereits finanziert. Die Kampagne läuft noch bis zum 10. Dezember.