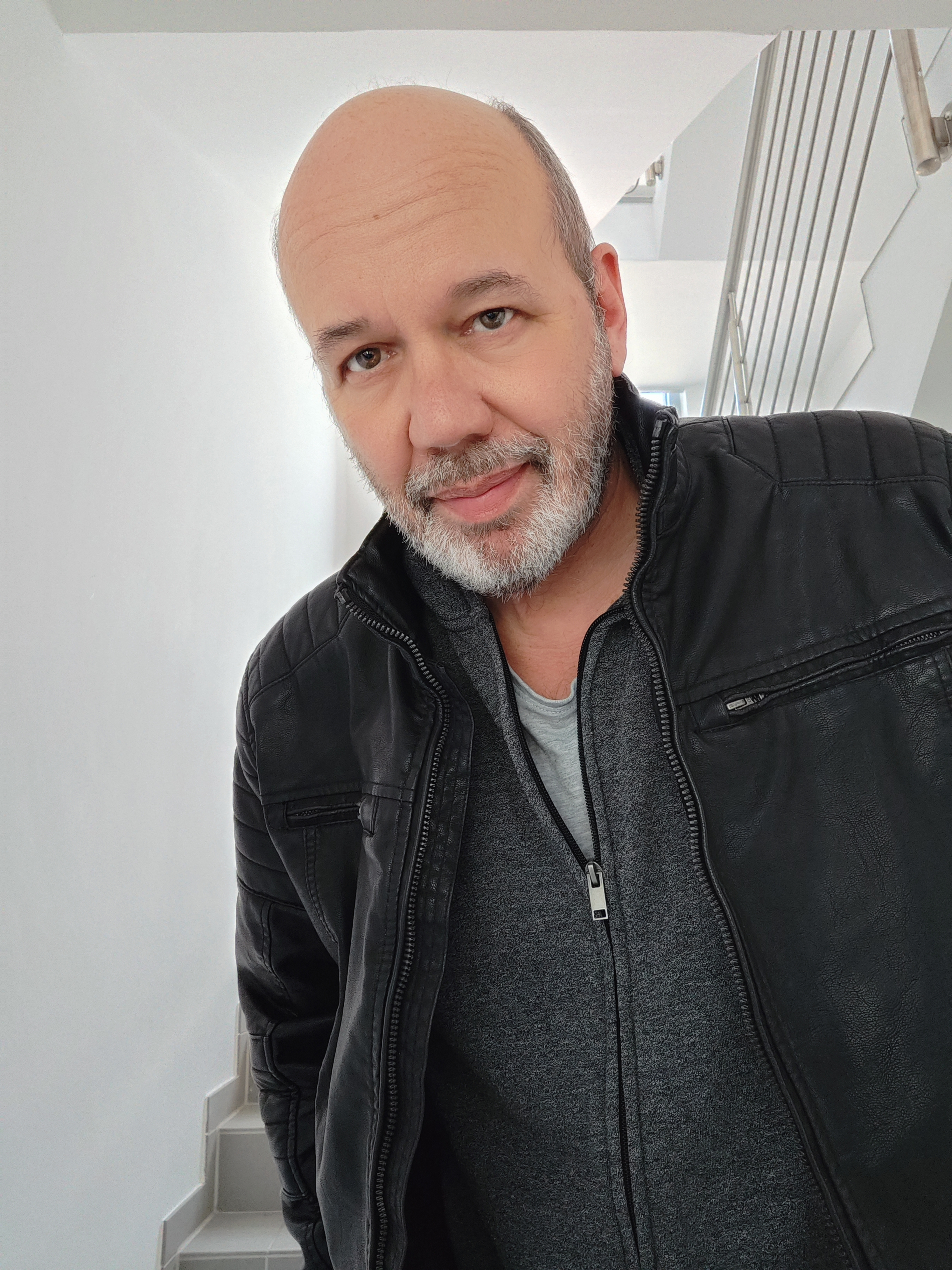Das jüdische Viertel von Rom fasziniert mit seiner direkt am Tiber gelegenen Großen Synagoge von 1904. Wer nach deren Besichtigung weiterläuft, kommt an zahlreichen koscheren Restaurants vorbei sowie an Judaika-Geschäften und der ältesten jüdischen Bäckerei der Stadt. Sie ist so bekannt, dass sie kein Schild mehr braucht. Touristen, die etwas weiter nördlich in der Via della Reginella landen, einer kleinen dunklen Gasse, wissen entweder sehr genau, wo sie hingehen wollen, oder sie haben sich verlaufen.
Ein schmales Haus, die Nummer 25, beherbergt ein auf den ersten Blick unscheinbares Ladengeschäft namens »Alefbet« und ist daher leicht zu übersehen. Wer sich nähert, wird schnell feststellen, dass die von Gabriele Levy betriebene Galerie mit angeschlossenem Laden einzigartig ist: Hier gibt es hebräische Buchstaben, so weit das Auge blickt, in allen Farben und Stilen, von Levy hergestellt aus den verschiedensten Materialien: von Ton und Stein bis hin zu Plastik, Glas, Metall und Holz. Immer gleich ist die Schriftart: Frank Ruhl Libre.
Nach der Lektüre zweier Bücher wechselte Levy vom Programmieren in die Kunst.
Viele Versionen der 22 hebräischen Buchstaben, von Alef bis Taw, hängen an den Wänden, von denen einige ein Teil der alten Stadtmauern Roms sind und zusammen mit den Exponaten für einen interessanten Kontrast sorgen. Auf vielen Buchstabenkacheln werden Länder, Städte, berühmte Persönlichkeiten oder Gegenstände dargestellt, die mit dem entsprechenden Buchstaben anfangen. Alle Objekte können sowohl bewundert als auch erstanden werden.
MARKT »Vor etwa 20 Jahren habe ich in Turin meinen ersten Laden aufgemacht. Es hat nicht funktioniert, denn der Markt ist nun einmal hier, im jüdischen Viertel von Rom«, sagt Gabriele Levy.
Nicht nur seine Galerie ist voller Überraschungen, sondern auch er selbst. Geboren wurde er in Buenos Aires. Bald fand er sich in Turin wieder. Von hier aus zog er 1980 nach Israel, lebte in einem Kibbuz und ging dann zum Militär. Später wurde Gabriele Levy Software-Ingenieur und erhielt eine Professur für Computer Sciences Engineering.
Der Wechsel in die Welt der Kunst erfolgte nach der Lektüre zweier Bücher, der Romane 1984 von George Orwell und Brave New World von Aldous Huxley. »Wir sehen, dass die Diktatur der Technologie näher kommt«, sagt er. »Ich wollte nicht Teil dieser Sache sein.« Und so eröffnete er etwas, das ganz weit davon entfernt ist, nämlich »eine Fabrik der hebräischen Buchstaben«, wie er es nennt.
länder Inzwischen befinden sich Gabriele Levys Kunstwerke überall auf der Welt. »Die meisten meiner Buchstaben gibt es in Italien, aber Hunderte sind in den verschiedensten Ländern zu finden, von England und Deutschland über Dänemark, Kanada, den USA bis nach Argentinien.«
In etwa 30 jüdischen Geschäften und Restaurants im Viertel dienen Levys Produkte als Wegweiser oder Dekoration. In einem Fall wurde mit seinen Buchstaben das Wort »koscher« an der Fassade eines Restaurants angebracht. Dieser Schriftzug ist nun auch über Google Street View zu sehen, was den 64-Jährigen stolz macht.
»Hebräische Buchstaben ziehen die Leute an. Sie haben Magie«, erklärt Levy die Popularität seiner Kunst. »Sie transportieren viele Inhalte – zum Beispiel sind sie auch die Basis für die Kabbala, die mystische Tradition des Judentums.« In der Via della Reginella war »Alefbet« die erste Galerie. Levy setzte offensichtlich einen Trend, denn inzwischen gibt es eine ganze Reihe davon.
DIMENSION Gabriele Levy ist nicht nur Kunsthandwerker, sondern tatsächlich auch Künstler. Er reichert seine Buchstaben manchmal mit originellen Ideen an, darunter »Hidden Art«. »So wie ein Maler zweidimensional arbeitet und der Bildhauer dreidimensional, zeige ich in diesem Werk, dass es vier Dimensionen gibt, denn die Zeit ist ja auch schon eine Dimension.«
Levy deutet auf eine Buchstabenskulptur, in die er mehrere Uhren eingebaut hat. Kürzlich habe er dieses Objekt einem kleinen Jungen gezeigt, erzählt er. »Und der Junge sagte: ›Uhren sind nicht die Zeit, sondern sie messen sie nur.‹« Daraufhin fügte Levy seinem Kunstwerk eine »versteckte Seite« hinzu, die eine Rotation der Buchstabenskulptur ermöglicht. »Wenn du sie drehst, geht sie tatsächlich durch die Zeit« und damit durch die vierte Dimension.
»Hebräische Buchstaben haben Magie. Sie ziehen die Leute an«, sagt Gabriele Levy.
Eine andere Idee von ihm ist »Modulare Kunst«: Einige der Uhren-Skulpturen, die man auch als Kacheln nutzen kann, haben Haken, sodass man weitere, kleine Kunstobjekte daran hängen kann. »So verändern sich die Kunstwerke«, erklärt Levy.
sortiment Andere Buchstaben-Kacheln wiederum können die Besitzer umdrehen, um sie zu verändern, da sie vom Künstler von beiden Seiten bearbeitet wurden. Darüber hinaus hat er auch phosphoreszierende Buchstaben im Sortiment. Es gibt keine Form, die seine hebräischen Lettern nicht einnehmen.
Nach den Jahren der Corona-Pandemie, die für ihn eine schwierige Phase waren, ist Gabriele Levy froh, dass die Touristen endlich wieder zurückgekehrt sind, nach Rom, ins jüdische Viertel und in die Via della Reginella.