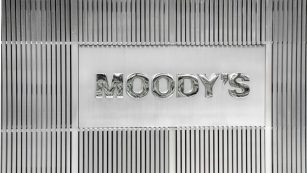Herr Klein Halevi, wie erleichtert waren Sie, als sich die israelische Regierung im Juni für den Schlag gegen den Iran entschied?
Ich habe schon vor 25 Jahren auf das Risiko eines nuklearen Irans hingewiesen. Das war nicht nur Netanjahus Krieg. Es war Israels Krieg, es war mein Krieg. Und so sehr ich Netanjahu sonst kritisiere – jeder Premierminister hätte mehr oder minder das gleiche gemacht. Schon Yitzhak Rabin wollte Frieden mit den Palästinensern, um sich auf das iranische Regime fokussieren zu können. Ich war freudig überrascht, als Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, dass Israel die »Drecksarbeit« für die Welt macht. Das war ein mutiges Statement, obgleich es so offensichtlich wie richtig ist. Wir mussten diesen Krieg führen. Genauso wie wir den Krieg in Gaza führen mussten. Er war notwendig und gerecht. Wir können keine Terroristen an unseren Grenzen dulden.
Dennoch wollen Sie, dass er nun zu Ende geht. Aus moralischen Gründen?
Nein. Weil die letzten Geiseln sonst nicht überleben werden. Und in dem Fall werden viele Israelis, die mit überwältigender Mehrheit für einen Geiseldeal sind, ihren Glauben an unser Ethos verlieren. Und ich habe Angst, dass unsere jungen Leute nicht mehr bereit sein werden, ihr Land zu verteidigen. In diesem Sinn sehe ich die Frage der Geiseln mehr in einem strategischen Rahmen als einem moralischen. Denn die Argumentation der Regierung ist nicht falsch und ebenfalls moralisch. Natürlich geben wir unseren Feinden das Gefühl, dass sie uns jederzeit erpressen können. Aber wir können nicht riskieren, die tiefe Solidarität zu verlieren, die unsere Bürger füreinander fühlen. Und der Krieg muss enden, weil die wachsende Gegnerschaft in großen Teilen der Welt unser Ansehen untergräbt.
Etliche dieser Reaktionen zeigen, wie wenig Verständnis der Westen für die Situation Israels hat.
Von Beginn an gab es diese starke Dissonanz zwischen den jüdischen Israelis – und übrigens den meisten Diasporajuden – und der nichtjüdischen Welt. Die Juden, auch die sehr Linken unter ihnen, von den Antizionisten abgesehen, verstanden intuitiv, dass es am 7. Oktober nicht um die Besatzung ging. Außer man denkt wie Hamas, dass die 1948 anfing. Es ging um radikalen Islam und den Vernichtungskrieg, den Islamisten gegen Israel führen. Die nichtjüdische Welt dagegen rief sehr schnell nach dem Kontext. Ex-Präsident Obama mahnte schon am 8. Oktober, den Kontext nicht zu vergessen. Doch ich glaube, das Massaker hätte genauso passieren können, wenn es einen palästinensischen Staat im Westjordanland gäbe. Denn es ging um »From the River to the Sea«. Die radikalen Studenten legen ihren Finger genau auf die Wunde, wenn sie diesen Slogan rufen. Sie wissen, worum es geht. Nur die alten Linken reden noch von zwei Staaten.
Sie selbst sprechen oft über die Kompliziertheit dieses Krieges.
Ja, weil dieser Krieg die zwei großen Versprechen des Zionismus gegeneinander ausspielt: Erstens Sicherheit und zweitens die Anerkennung des jüdischen Volkes als gleichberechtigter Teil der internationalen Gemeinschaft. Doch um wieder sicher zu sein, mussten wir einen Krieg führen, der so brutal und hässlich ist, dass wir unseren Status in der Welt zu verlieren drohen. Man sollte allerdings annehmen, dass zumindest Israels Freunde verstehen, dass Geografie Konsequenzen hat.
Neben der schwierigen Geografie gibt es die komplexe Geschichte Israels. Die scheint in der Kritik und Kontextualisierung verloren zu gehen.
Es ist schlimmer. Unsere Geschichte wird ausgelöscht.
Weil es leichter ist, »Genozid« zu tweeten als Komplexität zu beschreiben?
Und weil unsere Geschichte eine Geschichte ist. Sie ist 4000 Jahre alt. Es ist Geschichte, es ist ein Konflikt, beides ist kompliziert. Dafür hat keiner Geduld. Wir leben im Zeitalter von Social Media. Alles ist instant. Hinzu kommt diese vollkommen andere Sichtweise des Westens auf den Krieg, über die wir gesprochen haben.
Wie kann man diesen Prozess ändern?
Wir müssen ihn erst einmal verstehen. Vor einigen Monaten war ich in New York. An den Straßenlampen auf der Upper Westside hingen die Fotos der Geiseln. Jemand hatte mit einem Farbspray ihre Gesichter geschwärzt. Für mich wurde das zur Metapher für das Auslöschen unserer Historie. Antizionismus in seinem tiefsten Sinn ist ein Krieg gegen die jüdische Geschichte. Oder, um präziser zu sein, es ist der Krieg gegen die jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts nach dem Holocaust. Antizionismus will uns zurückführen in die hilflose Situation der Juden vor der Schoa.
Kann die Welt nicht mit starken Juden umgehen – mit Juden, die sich selbst ermächtigen?
Die Wurzeln liegen tiefer und sind verzwickter. Wir erfahren eine Auslöschung, die eine direkte Fortführung der christlichen Theologie im säkularen Raum ist. In der alten Theologie hatten wir Juden unsere eigene Geschichte aufgegeben. Sie gehörte nun der Kirche. Wir waren nicht mehr Israel. Die Kirche war nun Israel. Heute wird das säkular weitergeführt. Juden gehören nicht mehr zu ihrer eigenen Geschichte. Israel ist nicht mehr Israel. Es ist Palästina. Selbst die Schoa wird in diesem Narrativ zu einem Teil der anderen. Es ist nun der palästinensische Holocaust. Gaza ist das Warschauer Ghetto.
Das scheint das klassische Phänomen des Post-Schoa-Antisemitismus zu sein.
Einige brauchen die genozidalen Juden, um die Deutschen zu exkulpieren. Denn was es wirklich heißt, wenn Israelis nun die neuen Nazis sind, ist, dass jeder, der Macht hat, einmal handeln wird wie die Nazis. Früher waren es die Deutschen. Nun sind es die Juden. Hinzu kommt das Bild der Pharisäer, das auch säkulare Linke und Rechte in ihrem kulturellen Unterbewusstsein haben. Juden sind Pharisäer. Sie sind scheinheilig. Also lautet der Tenor: Sie sind schlimmer als die Nazis! 80 Jahre lang haben sie uns die Shoa vorgehalten – und nun tun sie dasselbe.
Auch einige Juden halten Israel ein solches Handeln vor. Wie reagieren Sie auf diese »jüdischen Stimmen«?
Wir müssen mit diesen Juden leben. Sie waren immer Teil unserer Geschichte. Doch sie belasten uns. Ganz ehrlich, ich wünschte, wir könnten eine Art Ältestenrat bilden, der über ihre Exkommunikation entscheiden. Nach dem Massaker in Hebron hat Yitzhak Rabin das gemacht. Er hat in der Knesset verkündet, er habe Baruch Goldstein exkommuniziert. Doch auch ein Premierminister kann Juden nicht rauswerfen aus dem Klub. Und ich bin nur halbironisch. Wo immer ich Einfluss habe in den USA, versuche ich die jüdische Gemeinschaft zu überzeugen, dass diese Leute gefährlich sind. Ich meine nicht diejenigen, die zu dem Schluss kommen, dass sie keine Zionisten sind, und bei denen es eine persönliche Haltung bleibt. Doch wenn jemand Teil der öffentlichen Kampagne gegen Israel wird, wenn er sich auf die Seite der Feinde stellt – dann ist die Grenze überschritten. Wie auch sonst im Judentum ist das Tun entscheidend.
Für dieses aktive Tun stehen Sie selbst. Wie kam es zu Ihrem Kampf für Israel, fürs jüdische Volk?
Es hat vor allem mit meinem Vater zu tun. Er war Überlebender und sprach viel vom Holocaust. Er wollte, dass meine Schwester und ich verstehen, wie man zum Opfer werden kann. Er wollte nicht, dass wir dumme Juden würden. Und die Definition dafür war, dass man Gefahren nicht erkennen konnte. Mein Vater zog mich auf mit dem Ziel, mein Leben dem jüdischen Volk zu widmen. Das war sein Lebenssinn. Ich war widerspenstig, doch gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, meinem Vater zu zeigen, dass es einen Grund hatte, dass er überlebt hatte. Das war garantiert ein Teil meiner Wahl. Und ich glaube immer noch, dass es keine interessantere Identität gibt, als Teil dieser jüdischen Geschichte zu sein.
Doch dann wurden Sie radikal, ein Anhänger des rechtsextremen, nationalistischen Politikers und Rabbiners Meir Kahane. Warum?
Ich war 17. Kahane war der erste amerikanisch-jüdische Führer, der wie mein Vater klang. Es war 1968, ein Jahr nach dem Sechstagekrieg, als er die jüdische Verteidigungsfront gründete. Wir wollten auch Helden sein, wie die Israelis. Und zu der Zeit hatte jede Minderheit ihre radikale Fraktion. Das war der Geist der Zeit. Nur dass die anderen Gebäude in die Luft sprengten im Namen des Friedens. Doch das Wichtigste: Der Meir Kahane, dem ich in den USA folgte, war nicht der Kahane, zu dem er dann in Israel wurde. Dort wurde er zum offenen Rassisten. Der Kahanismus, wenn sie so wollen, ist keine Ideologie, es ist eine fundamentalistische Religion.
Vielleicht gut, dass es damals noch kein Twitter gab, oder?
Oh, er hätte eine riesige Gefolgschaft aufgebaut … Er hatte einen zerstörerischen Einfluss, der sich heute in Teilen der Regierung bemerkbar macht. Es ist sein posthumer Sieg. Als er starb, war er eine Randfigur. Heute kontrolliert er durch die Ultra-Rechten große Teile der israelischen Politik.
Sie sind gegen diese Politik auf die Straße gegangen. Während der Justizreform haben Sie mit anderen moderaten Intellektuellen die Diasporajuden aufgerufen, ebenfalls zu protestieren. Würden Sie das noch einmal tun?
Wenn die Demokratie gefährdet ist, würde das liberale zionistische Israel sich wieder an die Diaspora wenden. Was ich mir dann wünsche, sind Tausende Juden vor allen Konsulaten und Botschaften. Nicht, um gegen etwas zu protestieren, sondern in Solidarität mit dem Israel, das sie lieben – Diasporajuden mit Tausenden israelischen Fahnen. Das Vorbild für Protest gegen israelische Regierungspolitik ist nicht Omer Bartov. Es sind die israelischen Demonstranten aus dem Sommer 2023. Wir sind gesegnet mit einer liberalen Opposition, die nicht weniger patriotisch ist als die Rechten. Ich selbst bin nicht links, sondern stehe politisch in der Mitte. Wir haben als leidenschaftliche Zionisten protestiert, die das zionistische Ethos bestätigen wollten. Da gab es nichts Universalistisches, es war alles tief verwurzelt in der Partikularität jüdischer Erfahrung. Und es war zutiefst patriotisch.
Mit dem Journalisten und Buchautor sprach Gunda Trepp.
Yossi Klein Halevi ist Fellow am Shalom-Hartman-Institut in Jerusalem und eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen Israels. Sein wöchentlicher preisgekrönter Podcast »For Heavenʼs Sake«, den er gemeinsam mit dem Rabbiner und Gelehrten Donniel Hartman macht, gehört zu den meistgehörten in den Vereinigten Staaten. Im Frühjahr 2026 erscheint sein New-York-Times-Bestseller »Letters to my Palestinian Neighbor« bei Hentrich & Hentrich in deutscher Übersetzung.